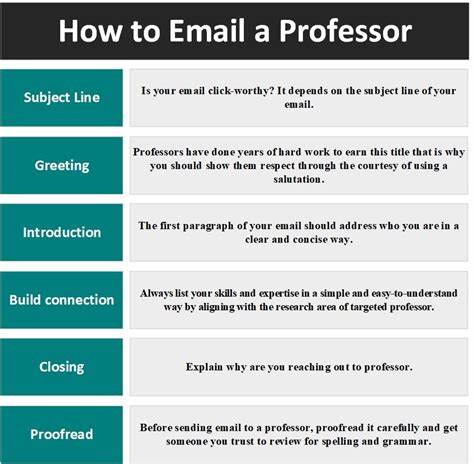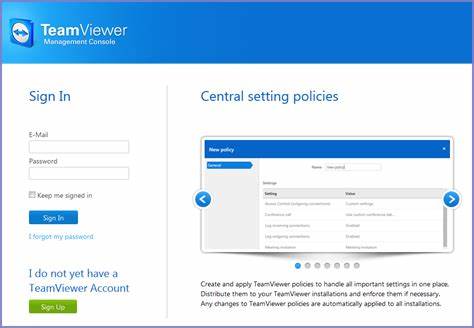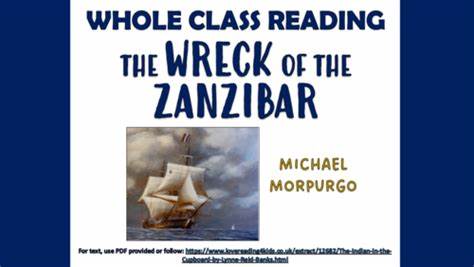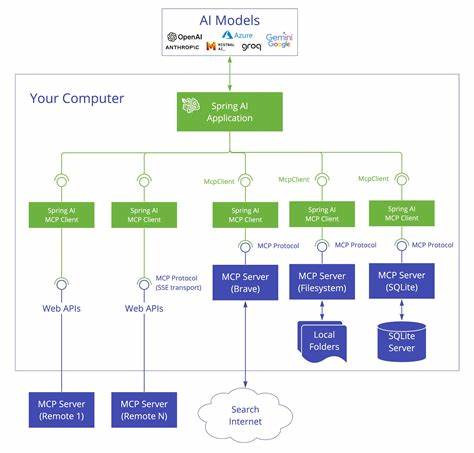Sake, das traditionelle japanische Reiswein-Getränk, gilt als ein Symbol japanischer Kultur und Kulinarik. Doch die reale Welt hinter der Herstellung dieses edlen Tropfens ist weit weniger romantisch, als man es sich oft vorstellt. Die Dokumentation „The Birth of Sake“ aus dem Jahr 2015 wirft einen intensiven und ehrlichen Blick auf die Tedorigawa-Brauerei im Ishikawa-Präfektur, die nicht nur durch ihre Tradition, sondern auch durch den alltäglichen Kampf ihrer Arbeiter besticht. Das Werk offenbart mehr als nur das Handwerk des Brauens – es zeigt die harte Realität der japanischen Arbeitswelt und den schwindenden Stellenwert von Sake in der modernen Gesellschaft. Die Tedorigawa-Brauerei ist keine uralte Institution, die seit Jahrhunderten unverändert existiert.
Sie wurde in der Meiji-Ära gegründet, eine Zeit bedeutender Modernisierung in Japan. Dennoch hält die Brauerei weitestgehend an traditionellen Herstellungsmethoden fest, die eine enorme körperliche Belastung für die Mitarbeiter bedeuten. Während der Brausaison, die den ganzen Winter andauert, leben die Arbeiter in der Brauerei in der Stadt, anstatt täglich nach Hause zu fahren. Die Schichten beginnen bereits um vier Uhr morgens in bitterkalter Dunkelheit. Das raue Klima mit Schnee, Eis und Nebel liefert zwar eine eindrucksvolle Kulisse für filmische Aufnahmen, doch die Realität für die Arbeiter ist von großen Entbehrungen geprägt.
Die Kamera begleitet vor allem den Nachfolger des Brauereibesitzers, der noch relativ jung ist und sichtlich mit der Last der Familienerwartungen ringt. Sein Alltag ist zweigeteilt zwischen der harten Winterarbeit im Inneren der Brauerei und der Vermarktung des Sake im wärmeren Rest des Jahres. Seine Versuche, den Sake international bekannt zu machen, zeigen sich zunehmend als wichtiger als die traditionelle Handwerkskunst selbst. Auf den Marktveranstaltungen und bei Verkostungen entpuppt sich der traditionelle Sake leider als weder außergewöhnlich noch besonders wettbewerbsfähig gegenüber moderneren oder importierten alkoholischen Getränken. Für viele Gäste wirkt Sake eher wie eine kuriose Neuheit, nicht aber wie das Kulturgut, das die Brauerei vermitteln möchte.
Interessant ist, wie die Dokumentation die Perspektive der Arbeiter einfängt. Diese sind keine sake-begeisterten Connaisseure, sondern überwiegend einfache Arbeitskräfte, die sich für die Wochen und Monate der Saison an die schwierigen Umstände gewöhnen. Oft gilt der Job als notwendiges Übel, da die meisten der Männer nach einer Saison aufgeben und andere, vermeintlich weniger belastende Arbeitsplätze suchen. Besonders eindrucksvoll ist die Schilderung eines Arbeiters, dessen Vater ein halbes Jahr in der Brauerei arbeitete und nur selten zu Hause war – eine menschliche Tragödie, die die Schattenseiten dieser jahrelangen Tradition verdeutlicht. Die Arbeitsbedingungen in der Brauerei erscheinen für Außenstehende geradezu erschreckend.
Die Nächte sind lang, die Temperaturen im tiefsten Winter oft unter Null, und der Zeitdruck lässt keine Pausen zu. Diese Umstände führen nicht nur zu physischer Erschöpfung, sondern auch zu einer alarmierenden Rate körperlicher Erkrankungen. Ein zentraler Moment der Dokumentation ist das plötzliche Herzversagen eines vergleichsweise jungen Mitarbeiters während einer Karaoke-Session, was die Frage aufwirft, wie nachhaltig ein solches Leben für die Gesundheit ist. Der Film zeichnet damit kein nostalgisch verklärt Bild der japanischen Handwerkskunst, sondern fordert den Zuschauer heraus, die moderne Realität von Tradition und Fortschritt kritisch zu hinterfragen. Hier zeigt sich eine Spannung zwischen der Wertschätzung für eine jahrhundertealte Kultivierungskunst und den ökonomischen Realitäten einer schrumpfenden Nachfrage.
Sake verliert zunehmend an Beliebtheit, vor allem bei jüngeren Japanern und internationalen Verbrauchern, die oft zu einfacheren, günstigeren Getränken greifen. Der Fokus auf die sozialen Aspekte rund um die Brauerei macht deutlich, dass es weniger um das Getränk selbst als vielmehr um den Lebensstil und die Kultur geht, die es einst begleitet hat. Die Gemeinschaft der Arbeiter lebt vor allem in der Saison zusammen und findet dort auch sozialen Halt. Dennoch wirkt dies wie ein notdürftiges Pflaster auf eine schrumpfende Branche, die riskieren könnte, früher oder später ganz zu verschwinden. Ein weiteres Thema, das durch die Dokumentation deutlich wird, ist der Mangel an Innovation und Anpassungsfähigkeit.
Die Brauerei betont, ihre Methoden nicht grundlegend zu verändern, was einerseits als Pflichtbewusstsein gegenüber der Tradition interpretiert werden kann, andererseits aber als gefährliche Beharrlichkeit im Angesicht des Wettbewerbs. Wie in vielen traditionellen Handwerken zeigt sich auch hier, dass Innovation und Modernisierung essenziell sind, um langfristig überleben zu können. Da die Leidenschaft für Sake bei Arbeitern, Vermarktung und Konsumenten eher schwach ausgeprägt ist, bleibt fraglich, wie sich der Sake-Markt entwickeln wird. Während der Film endet, ohne eine klare Antwort anzubieten, bleibt die Hoffnung, dass dokumentarisches Engagement und internationale Aufmerksamkeit für die seltene Kulturform eine Renaissance anstoßen könnten. Insgesamt bietet „The Birth of Sake“ einen ungewöhnlichen und tiefgründigen Einblick in eine Welt, die für viele unerreichbar bleibt.
Die Dokumentation ist nicht einfach nur eine Hommage an ein traditionelles Getränk, sondern ein Porträt menschlicher Ausdauer, familiärer Verantwortung und kultureller Veränderungen in einer zunehmend globalisierten Welt. Wer mehr als nur das Endprodukt verstehen möchte, findet hier ein Zeitdokument, das lückenlos die Herausforderungen und Schönheiten des traditionellen Sake-Handwerks enthüllt und gleichzeitig zum Nachdenken über den Wert von Tradition und Arbeit einlädt.