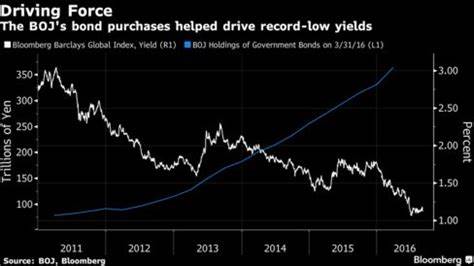Auf der abgelegenen Insel Jicarón, die Teil des Coiba Nationalparks vor der Küste Panamas ist, haben Forscher eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht: Jugendliche Kapuzineraffen (Cebus capucinus imitator) entführen die Babys einer anderen Primatenart, nämlich die Jungtiere der panamaischen Brüllaffen (Alouatta palliata coibensis). Dieses Verhalten ist einzigartig und wirft viele Fragen über die soziale Dynamik, die kognitiven Fähigkeiten und die Einflüsse der Umwelt auf das Verhalten dieser Tiere auf. Die Aufzeichnungen des Max-Planck-Instituts für Verhaltensforschung dokumentieren, dass die Entführungen keinen offensichtlichen biologischen oder evolutionären Vorteil für die Kapuzineraffen bieten. Die Brüllaffenbabys sterben fast ausnahmslos nach einigen Tagen in Gefangenschaft der Jugendlichen, da diese sie weder pflegen noch füttern, sondern lediglich tragen, oft ignorieren oder bei Fluchtversuchen sogar angreifen. Dieses Verhalten, das weder als Fürsorge noch als direkter Angriff eingestuft werden kann, erinnert paradoxerweise an Langeweile mehr als an bewusste Aggression oder Nutzen.
Traditionell wurde angenommen, dass Handlungen wie Kindesmord oder Rivalenkonflikte bei Primaten einem klaren Selektionsdruck folgen – das bedeutet, dass solche Verhaltensweisen der Fortpflanzung oder der Ressourcensicherung dienen. Löwen oder Hyänen etwa töten die Nachkommen von Konkurrenten, um ihre eigene Erbfolge zu sichern. Aber im Fall der Kapuzineraffen auf Jicarón Island passt das Muster nicht in dieses Schema. Die Entführungen sind quer zu den üblichen adaptiven Verhaltensweisen und zeigen, dass komplexe soziale und kognitive Prozesse auch ohne direkte evolutionäre Vorteile entstehen können. Die Beobachtung begann im Jahr 2017 durch ein Netzwerk aus fast 100 versteckten Kameras mit Bewegungssensoren, die rund um die Insel verteilt aufgestellt worden waren, um das Verhalten der Primaten zu dokumentieren.
Die Forscher stießen zufällig auf Videoaufnahmen eines jungen Kapuzineraffen, der die Winzlinge der Brüllaffen auf seinem Rücken trug. Sie tauften den Initiator der ungewöhnlichen Verhaltensweise „Joker“. Zunächst blieb das Ereignis isoliert und schien ein Einzelfall zu sein. Doch im Laufe der nächsten Monate und Jahre konnten die Wissenschaftler beobachten, wie weitere jugendliche Kapuzineraffen das Verhalten von Joker imitierten. Die Gruppe der Nachahmer wurde zunehmend grober gegenüber den gefangenen Babys.
Während anfangs noch eine gewisse Spannung zu beobachten war, gipfelte das Verhalten schließlich darin, dass die Babys nicht mehr beschützt oder umsorgt wurden, sondern eher als Spielzeug oder Belastung behandelt wurden, bis ihr Tod folgte. Diese Verhaltensweise wirft ein Schlaglicht auf die Komplexität und die Grenzen tierischer Kognition. Einige Experten spekulieren, dass die sichere Insellage der Kapuzineraffen – ohne natürliche Fressfeinde und mit einem begrenzten, relativ ungefährlichen sozialen Umfeld – zu einer verminderten sozialen Kontrolle und größerem Spielraum für ungewöhnliche Verhaltensweisen führen könnte. In einer solch stimulanzarmen Umgebung könnten die Tiere kreative, aber letztlich maladaptive Verhaltensformen zeigen, um sich selbst zu beschäftigen oder neue soziale Rollen auszuprobieren. Besonders interessant ist die Verbindung zwischen dieser entdeckten Form von Entführungen und der bereits zuvor auf der Insel beobachteten Fähigkeit der Kapuzineraffen, Steinwerkzeuge zu benutzen.
Die Gruppe von Jicarón wurde unter anderem dafür bekannt, dass sie Steine als Hammer und Amboss nutzte, um harte Schalen von Früchten oder Krebsen zu öffnen. Diese Fähigkeit ist extrem selten bei dieser Affenart und stellt sie kognitiv auf eine Stufe mit einigen der intelligentesten Primaten. Die Nutzung von Werkzeugen und die Entführung fremder Babys scheinen auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun zu haben. Doch beide Verhaltensweisen könnten Ausdruck eines hohen Grades an Neugier und explorativem Verhalten sein, das sich in einer sicheren, ressourcenreichen Umwelt zwar entfalten, aber fehlgeleitet werden kann. Es ist denkbar, dass die fehlende natürliche Bedrohung und die reduzierte soziale Struktur des Insellebens dazu führen, dass sich Verhaltensweisen etablieren, die außerhalb eines solchen Mikrokosmos keinen evolutionären Sinn ergeben.
Die Rolle der Sozialstruktur ist dabei entscheidend. Junge Kapuzineraffen sind hoch soziale Tiere, die normalerweise von den Älteren in ihrem Verhalten kontrolliert werden. Auf Jicarón Island aber zeigt sich, dass der Mangel an sozialem Druck dazu führen kann, dass Verhaltensweisen entstehen und sich verbreiten, die keiner logischen ökologischen Funktion dienen. Die Nachahmung des Verhaltens von Joker durch andere männliche Jungaffengeprägt ein kulturelles Muster, das nicht umsonst als sogenannter „traditioneller Brauch“ beschrieben wird, der jedoch negativ für die Überlebenschancen der Brüllaffenbabys ist. Die Forschung offenbart zudem die Grenzen menschlicher Moralvorstellungen, wenn es um tierisches Verhalten geht.
Die Forscherin Meg Crofoot weist darauf hin, dass das Konzept von „Böse“ oder „Moral“ schwer auf Tiere übertragbar ist, da ihnen möglicherweise das notwendige Bewusstsein und die Selbstreflexion fehlen, um ihr Handeln in ethischen Kategorien zu bewerten. Die Kapuzineraffen verhielten sich nicht absichtlich grausam, sondern ohne das Verständnis für das Leid, das sie verursachen. Dies wirft grundsätzliche Fragen über wie wir tierisches Verhalten interpretieren und bewerten, und wie weit kognitive Fähigkeiten und Empathie bei nicht-menschlichen Arten reichen. Die Auswirkungen dieses Verhaltens gehen über die direkte Biologie hinaus und betreffen auch das Verständnis von Kultur, Lernen und sozialer Evolution bei Primaten. Die Fähigkeit, Verhalten zu kopieren und eine Tradition ohne klaren Vorteil aufrechtzuerhalten, zeigt Parallelen zu menschlichen sozialen Dynamiken und zu Phänomenen wie Gruppenverhalten oder Moden, die nicht rational zu erklären sind.
Neben der wissenschaftlichen Bedeutung hat die Entdeckung auch ökologische Implikationen. Da die Brüllaffenbabys durch dieses Verhalten sterben, könnte es auf längere Sicht die Population der Brüllaffen auf der Insel gefährden und somit das ökologische Gleichgewicht stören. Das Beispiel illustriert, wie selbst kleine Veränderungen im Sozialverhalten großer Einfluss auf eine Population und letztlich auf das gesamte Ökosystem haben können. Insgesamt eröffnet die Entdeckung der Jugendlichen Kapuzineraffen, die fremde Affenkinder entführen, einen einzigartigen Einblick in das komplexe Zusammenspiel von Umwelt, Sozialverhalten und Kognition bei Primaten. Während die genaue Motivation und die langfristigen Auswirkungen weiterhin erforscht werden müssen, bieten die Beobachtungen von Jicarón wichtige Impulse dafür, wie Tierverhalten durch freie Zeit, soziale Strukturen und ökologische Sicherheit beeinflusst wird.
Sie zeigen auch, dass tierische Intelligenz nicht nur pragmatisch, sondern auch vielfältig und manchmal rätselhaft agiert – ein Spiegelbild der umfassenden Komplexität des Lebens selbst.