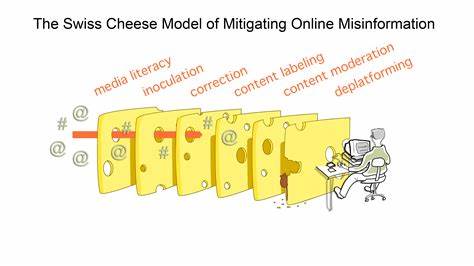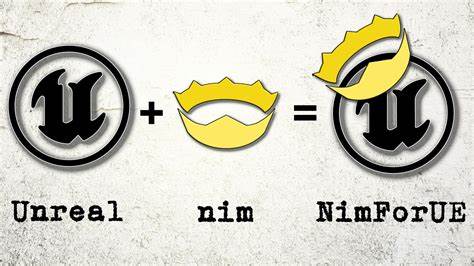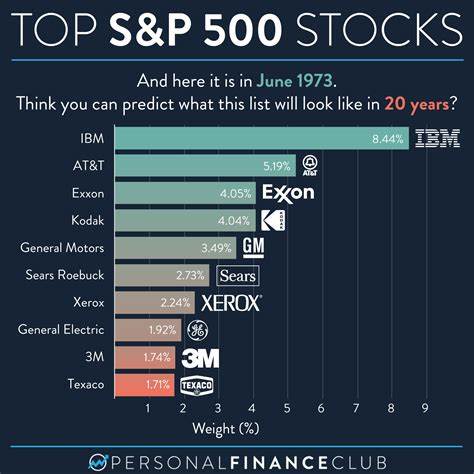Die Energiewende und die zunehmende Integration von erneuerbaren Energiequellen wie Wind- und Solarenergie stellen die Stromnetze weltweit vor neue Herausforderungen. Eine dieser Herausforderungen ist die sogenannte Netzträgheit oder Netzinertia, ein Begriff, der im Zusammenhang mit der Stabilität und Verlässlichkeit des Stromversorgungssystems eine zentrale Rolle spielt. Netzträgheit bezeichnet die Fähigkeit des elektrischen Netzes, plötzliche Frequenzschwankungen abzufedern. Diese Schwankungen entstehen, wenn die Stromerzeugung und der Verbrauch nicht im Gleichgewicht sind – zum Beispiel durch den plötzlichen Ausfall einer größeren Erzeugungseinheit oder eine unerwartete Nachfragespitze. Traditionelle Kraftwerke wie Kohle- oder Gaskraftwerke verfügen über große rotierende Massen, insbesondere in Form von Generatoren und Turbinen, die kinetische Energie speichern.
Diese gespeicherte Energie wirkt wie ein Puffer und stabilisiert kurzfristig die Netzfrequenz. Im Gegensatz dazu erzeugen erneuerbare Quellen wie Wind- und Solaranlagen Strom über Wechselrichter, die keine synchrone Trägheit in das System einbringen. Dies führt zu einem Rückgang der Gesamtträgheit im Netz und damit zu einer erhöhten Anfälligkeit gegenüber Frequenzabweichungen, was im schlimmsten Fall zu großflächigen Stromausfällen führen kann. Ein markantes Beispiel für diese Problematik ist der großflächige Stromausfall auf der Iberischen Halbinsel, der teilweise auf einen Mangel an Netzträgheit zurückgeführt wird. Während eines Tages mit geringer Last und hohen Anteilen an Wind- und Solarstrom – etwa 63 Prozent – fehlte dem Netz die nötige kinetische Energie, um plötzliche Laständerungen auszugleichen.
Da Wind- und Solaranlagen keine rotierenden Massen besitzen, hatte das Netz weniger Zeit, auf Störungen zu reagieren, was eine Kaskade auslöste, die schlussendlich zu einem Blackout führte. Diese Ereignisse haben die Diskussion über die Kosten und die technische Notwendigkeit von Netzträgheit neu entfacht. Die Frage lautet: Wie viel kostet es, die fehlende Trägheit in einem zunehmend erneuerbaren Energiesystem zu ersetzen? Und welche technologischen Alternativen gibt es, um die Netzstabilität sicherzustellen? Ein konventioneller Lösungsansatz besteht darin, sogenannte synchrone Kondensatoren zu installieren. Dabei handelt es sich um Geräte, die im Grunde genommen wie Generatoren arbeiten, jedoch keine Energie ins Netz einspeisen, sondern lediglich kinetische Energie speichern und so Netzträgheit bereitstellen. Oft werden diese Systeme mit Schwungmassen (Flywheels) kombiniert, die in einer Luftleere rotieren, um Reibungsverluste zu minimieren und die gespeicherte kinetische Energie für schnelle Frequenzkorrekturen nutzbar zu machen.
Ein aktuelles Beispiel findet sich im Vereinigten Königreich: Dort wurden am Lister Drive nahe Liverpool zwei solcher Anlagen installiert, die gemeinsam eine gespeicherte Energie von etwa 900 Megawattsekunden bereitstellen – ungefähr so viel wie ein 225-Megawatt-Kohlekraftwerk. Die Kosten für diese Installation beliefen sich auf rund 33 Millionen US-Dollar, was etwa 7 Prozent der Kosten für den Bau eines gleichwertigen Kohlekraftwerks entspricht. Diese Zahl erstaunt insofern, als dass die Ausgaben für Netzträgheit bei der Planung von erneuerbaren Energieanlagen oft unterschätzt oder gar nicht berücksichtigt werden. Betrachtet man die Beispielkosten im Verhältnis zu einem Solarpark mit einer installierten Leistung von einem Gigawatt, der etwa eine Milliarde US-Dollar in Anspruch nimmt, würde die Bereitstellung von trägerheitsähnlicher Stabilität rund 150 Millionen Dollar kosten – das entspricht etwa 15 Prozent der Investitionssumme. Hochgerechnet auf die effektive Leistung – die aufgrund der Volatilität von Sonne und Wind meist nur bei rund 30 Prozent der Nennleistung liegt – ergibt sich ein zusätzlicher Kostenfaktor von circa 500 Dollar pro installierter Kilowattstunde.
Diese Investitionen sind notwendig, um eine vergleichbare Zuverlässigkeit wie in einem konventionellen Kraftwerk zu gewährleisten. Die Zahlen verdeutlichen, dass Netzträgheit ein kostspieliger, aber unverzichtbarer Bestandteil eines stabilen Stromnetzes ist. Allerdings ist es denkbar, dass weniger Trägheit ausreicht, wenn die Netzplanung auf Kompromisse bei der Zuverlässigkeit eingeht – was wiederum ein Risiko darstellen kann. Alternativ ziehen Netzbetreiber und Technologieunternehmen den Einsatz von Energiespeichern wie Batterien in Betracht, die durch schnelle Leistungsausregelung Spannungsschwankungen ausgleichen können. Moderne Batterien, gekoppelt mit intelligenten Steuerungssystemen, besitzen die Fähigkeit, in Sekundenbruchteilen auf Frequenzänderungen zu reagieren.
Theoretisch könnten sie damit die Funktion der rotierenden Massen teilweise oder sogar vollständig ersetzen. Diese Kombination aus Speichern und Leistungselektronik, bekannt als „synthetische Trägheit“ oder „virtuelle Trägheit“, soll das Netz stabil halten und die Systemresilienz stärken. Trotz dieses Potenzials investieren Netzbetreiber weiter in synchrone Kondensatoren. So scheint die Technologie derzeit verlässlicher oder wirtschaftlicher als Batterielösungen, zumindest wenn man die derzeitigen Kosten und die technische Reife berücksichtigt. Neben diesen technischen und finanziellen Herausforderungen ist auch die Rolle smarter Wechselrichter von zentraler Bedeutung.
Die Wechselrichter von Wind- und Solaranlagen sind entscheidend für die Interaktion mit dem Stromnetz. Ein typisches Problem ist, dass bei starken Frequenz- oder Spannungsabweichungen einfache Wechselrichter automatisch abschalten, um Schäden zu vermeiden. Wenn jedoch viele Anlagen gleichzeitig ausfallen, weil sie sich schützen, wird genau die Situation verschärft, die zu einem Blackout führt. Deshalb entwickeln Hersteller sogenannte „intelligente“ Wechselrichter, die die Fähigkeit besitzen, kurzfristige Störungen durch Kurzzeitbetrieb trotz Unregelmäßigkeiten zu überbrücken. Diese sogenannte „Ride-Through“-Funktion erlaubt es den Anlagen, trotz Turbulenzen am Netz angeschlossen zu bleiben und damit zur Systemstabilität beizutragen.
Die Koordination einer Vielzahl solcher dezentraler Einrichtungen stellt jedoch eine große technische Herausforderung dar, wie der Iberische Blackout gezeigt hat. Die Netzbetreiber müssen sicherstellen, dass alle Anlagen im Verbund ähnlich reagieren, um gefährliche Schwingungen oder Instabilitäten zu vermeiden. Trotz der guten Absichten steckt dieses Gebiet noch in der Entwicklung. Der Übergang zu einem energiesystem mit hohem Anteil erneuerbarer Energien erfordert, dass solche technischen Herausforderungen adressiert und die wahren Kosten der Netzstabilität transparent gemacht werden. Die Vorstellung, dass erneuerbare Energien die Kosten des Stromsystems automatisch senken, greift zu kurz, wenn die notwendigen Investitionen in Netzregelung und Stabilisierung nicht mitzurechnen sind.
Auch wenn saubere Energiequellen günstig erhältlich sein mögen, so entstehen Kosten durch die Sicherstellung der Netzstabilität, die in der Gesamtbetrachtung berücksichtigt werden müssen. Ingenieure und Entscheidungsträger sind daher gefordert, umfassende und realistische Modelle zu entwickeln, die neben Investitions- und Betriebskosten auch die Ausgaben für Netzträgheit und Zuverlässigkeit abbilden. Nur so kann eine echte Vergleichbarkeit unterschiedlicher Energiesysteme hergestellt werden. Abschließend ist die Frage, wie ein optimaler Energiemix zukünftig aussehen sollte, nach wie vor offen. Stimmen die Zahlen, wird es auch in einem „grünen“ Stromsystem weiterhin eine Rolle für flexible Kraftwerke mit kinetischer Energie geben – zumindest bis alternative Technologien wie verbesserte Batteriespeicher oder fortschrittliche Steuerungselektronik in ausreichender Menge und Wirtschaftlichkeit verfügbar sind.
Das bedeutet, dass erneuerbare Energien zusammen mit ergänzenden Technologien und konventionellen Kraftwerken koexistieren müssen, um Versorgungssicherheit und Netzstabilität zu garantieren. Die Kosten der Netzträgheit sind somit ein wesentlicher Faktor in der Diskussion um den Ausbau und die Gestaltung zukünftiger Stromnetze und sollten keinesfalls unterschätzt werden.