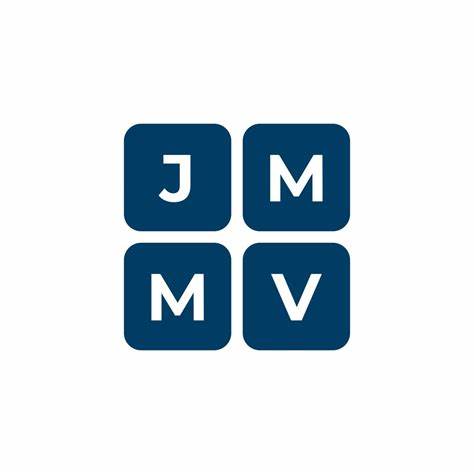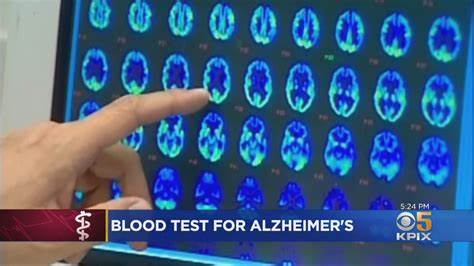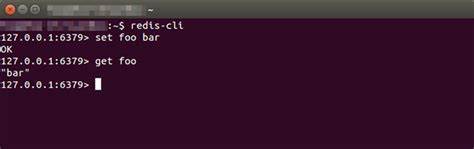In der heutigen digitalen Welt erwarten wir von Computern, dass sie extrem schnell und reaktionsfreudig sind. Dennoch schildern viele Nutzer, dass moderne Geräte, obwohl technisch deutlich leistungsfähiger, bei einfachen Aufgaben wie dem Öffnen von Programmen langsamer oder träge wirken als ältere Maschinen. Diese Beobachtung ist kein subjektives Gefühl, sondern lässt sich mit nachvollziehbaren technischen Hintergründen erklären. Julio Merino, erfahrener Softwareentwickler und Blogger, hat dieses Thema auf seinem Blog jmmv.dev ausführlich beleuchtet und kontroverse Impulse gesetzt, die eine breite Diskussion ausgelöst haben.
Ein Blick zurück in die Zeit um das Jahr 2000 zeigt, wie Verbraucher damals mit Hardware ausgestattet waren, die im Vergleich zu heute rudimentär erscheint: Ein AMD-K7-Prozessor mit 600 MHz, 128 MB RAM und eine langsame Festplatte mit 5400 Umdrehungen pro Minute konkurrieren mit heutigen Geräten, die mit Mehrkern-CPUs, SSD-Speichern und 8 GB oder mehr Arbeitsspeicher glänzen. Trotz dieser Leistungsunterschiede demonstriert Julio Merino in Vergleichsvideos eindrucksvoll, dass das Starten einfacher Anwendungen wie Notepad oder der Kommandozeile auf einem Rechner mit Windows NT 3.51 aus dem Jahr 1999 wesentlich schneller wirkt als auf einem aktuellen Gerät mit Windows 11. Dies führt zu der berechtigten Frage, wie es sein kann, dass Computer trotz exponentiell gestiegener Rechenleistung und verbesserten Speichertechnologien eine scheinbare Verschlechterung in der Systemreaktivität erfahren. Die Antwort darauf ist vielschichtig und betrifft sowohl Software- als auch Hardware-Aspekte.
So müssen etwa moderne Betriebssysteme oft wesentlich komplexere Aufgaben bewältigen, verfügen über grafikintensive Benutzeroberflächen, führen background-Prozesse aus und unterstützen eine Vielzahl von Anwendungen gleichzeitig. Das führt zwangsläufig zu einer größeren Belastung der Ressourcen. Allerdings erklärt allein die gestiegene Komplexität nicht vollständig, warum vor allem simple Interaktionen wie das Starten von kleinen Systemprogrammen spürbar langsamer vonstattengehen. Interessanterweise zeigt sich eine ähnliche Beobachtung sowohl bei Windows als auch bei macOS und in gewissem Maße sogar bei Linux. Besonders bei Windows haben sich native Anwendungen wie Notepad zugunsten moderner Plattformen wie UWP (Universal Windows Platform) oder Electron-basierte Applikationen verändert, was eine höhere Startzeit und mehr Ressourcenverbrauch mit sich bringt.
Der Einfluss von sogenannten Frameworks und Abstraktionsschichten ist hierbei nicht zu unterschätzen. Viele moderne Apps greifen auf größere Plattformen zurück, die eine schnellere Entwicklung ermöglichen, aber häufig auf Kosten der Performance gehen. Electron beispielsweise erlaubt die Nutzung von Webtechnologien für Desktop-Anwendungen und bringt damit eine zusätzliche Laufzeitumgebung mit, die mehr Speicher und Rechenleistung benötigt. Große Softwarehersteller entscheiden sich aus wirtschaftlichen Gründen oft für solche Lösungen, da sie plattformübergreifend Entwicklern Zeit und Aufwand sparen, nicht aber den Nutzern Vorteile bringen – abgesehen von einer vereinheitlichten Bedienung. Darüber hinaus spielen Programmiersprachen und Laufzeitumgebungen eine Rolle.
Verwaltet ausgeführter Code in Sprachen wie Java oder C# führt zwar zu mehr Sicherheit und einfacher Wartbarkeit, bringt aber für den Nutzer meist eine höhere Latenz mit sich. Gerade der Start von Programmen wird dadurch verlangsamt, da zunächst die Laufzeitumgebung geladen, Initialisierungen durchgeführt und Just-in-Time-Kompilierungen erledigt werden müssen. Das ist ein grundsätzlicher Unterschied gegenüber kompiliertem nativen Code, der direkt von der Hardware ausgeführt wird und somit schneller startet. Ein weiterer entscheidender Punkt ist das Paradoxon der Hardwarefortschritte. Technisch betrachtet hat sich die Geschwindigkeit von CPUs, die Bandbreite von Speichern und vor allem die Zugriffszeiten von Datenträgern enorm verbessert.
Der Wechsel von mechanischen Festplatten zu SSDs markierte hier einen Meilenstein, der für massive Verbesserungen bei der Reaktionszeit von Systemen sorgte. Leider hat sich dieses Verbesserungsniveau nach dem Einzug von SSDs bei herkömmlichen Consumer-Computern kaum weiterentwickelt. Neue Technologien, die erneut solche Sprünge bewirken könnten, sind kaum greifbar oder werden von der Software nicht effektiv genutzt. Zudem hat die Entwicklung zu hochauflösenden Displays und komplexeren grafischen Benutzeroberflächen potenziell Einfluss auf die wahrgenommene Geschwindigkeit. Während Merino argumentiert, dass Grafikprozesse heute von GPUs übernommen werden und somit CPUs entlasten, sind manche Grafikanimationen und visuelle Effekte für den Nutzer als Verzögerung spürbar.
Dennoch sind die Verzögerungen beim Öffnen von einfachen Programmen unabhängig von solchen Effekten und finden ihre Wurzeln tief im Systemdesign und der Softwarearchitektur. Die Netflixisierung und Googleisierung der Softwarewelt – der Trend weg von schlanken nativen zu mächtigen, aber ressourcenhungrigen Web-Technologien – hat einen weiteren negativen Effekt auf die Performance. Obwohl Fitness- und Lifestyle-Apps, Videobearbeitungsprogramme oder Cloud-Dienste in den letzten zwei Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht haben, zeigen sich bei praktischen Benchmarks im Alltag oft deutliche Nachteile. Innerhalb großer Unternehmen wird hier Technologie eingesetzt, die ursprünglich für Webdienste gebaut wurde, aber als Desktop-Applikationen aufgeblasen werden, was insbesondere bei Geräten ohne High-End-Hardware zu Frust führt. Der Linux-Bereich scheint in diesem Vergleich noch am wenigsten betroffen.
Dort bleiben die Desktopsysteme auf vielen Computern bis heute recht schlank und reagieren recht flott, sofern die Hardwarebasis grundlegend ausreicht. Dennoch treten auch hier Grenzen auf, sobald komplexe Anwendungen, die eigentlich für Windows oder Mac entwickelt wurden, per Kompatibilitätsschicht oder in virtuellen Umgebungen genutzt werden. Auch der Linux-Hype ändert nichts daran, dass die grundlegende Herausforderung darin besteht, einen Hardwareboost mit effizienten Softwarelösungen zu begleiten. Ein weiterer Aspekt, den Merino hervorhebt, ist die Priorisierung von Entwicklerzeit gegenüber Laufzeitperformance. Unternehmen und Entwickler setzen oft die schnellstmögliche Produktentwicklung an erste Stelle, weniger die Bestleistung in puncto Geschwindigkeit und Effizienz.
Diese Kalkulation führt dazu, dass Software schnell fragil, aufgebläht und ineffizient wird – auf Kosten der Nutzererfahrung. Performanceoptimierung wird häufig nur in Spezialfällen wie Spielen oder grafikintensiven Anwendungen ernsthaft verfolgt, nicht bei alltäglichen Tools. Das Resultat sind Programme, die auf jedem neuen Gerät mehr Ressourcen einfordern und deren Ladezeiten sich verlängern. Dies wirft die Frage auf, ob die Rechner- und Softwareentwicklergemeinschaft diesen Trend umkehren kann. Revolutionäre technologische Sprünge wie der Übergang von HDD auf SSD sind selten und nahezu einmalig.
Apples M1-Chip zum Beispiel zeigte große Effizienz- und Leistungssteigerungen, die jedoch durch fortschreitende Softwarezyklen und steigende Anforderungen wieder verringert werden. Die Gefahr besteht darin, dass ohne grundlegende Änderungen die wahrgenommene Performance zukünftig weiter abnimmt oder zumindest stagniert. Die Lösung könnte in einer Rückbesinnung auf Lean-Development, native Programmierung in performanteren Sprachen und einer stärkeren Berücksichtigung von Nutzerfeedback liegen. Software sollte dort optimiert werden, wo sie am meisten gebraucht wird, um unnötigen Overhead zu vermeiden. Parallel dazu muss hardwareseitig weiter in neue Technologien investiert werden, die tatsächliche und spürbare Performancevorteile bringen, beispielsweise Weiterentwicklungen im Bereich Speicherarchitektur, schnelleren Caches oder alternativen Rechenparadigmen.