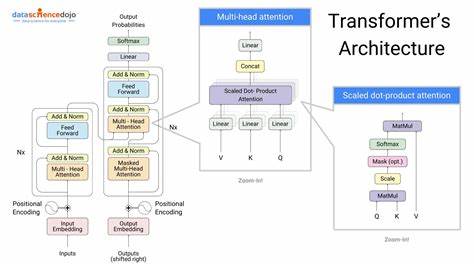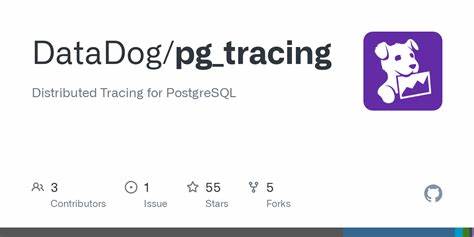In der weiten Vielfalt menschlicher Kulturen gelten Tanz und Wiegesänge als tief verwurzelte und universelle Ausdrucksformen unseres Menschseins. Sie verbinden Gemeinschaften, erleichtern soziale Bindungen und spielen eine zentrale Rolle in der Entwicklung von Kindern. Doch aktuelle ethnomusikologische Forschungen bei den Nordlichen Aché, einer indigenen Jäger-und-Sammler-Gruppe im Osten Paraguays, zeigen einen überraschenden Befund: Diese Gesellschaft zeigt weder Tanz noch infantilen Wiegesang. Dieses Verschwinden stellt lange Zeit als universell angesehene kulturelle Phänomene infrage und liefert wertvolle Erkenntnisse über die Dynamik menschlicher Kultur und Evolution. Die Aché lebten bis in die 1970er Jahre als Vollzeitjäger und -sammler in den neotropischen Wäldern Paraguays, wobei die nördliche Untergruppe, die Nordlichen Aché, wegen ihrer minimalen Akkulturation eine einzigartige Gelegenheit zur Erforschung kultureller Traditionen darstellt.
Über einen Zeitraum von insgesamt mehr als zehn Jahren intensiver Feldforschung, in der Forscher in zahlreichen Nächten Seite an Seite mit den Aché lebten, wurden über 3000 Nächte direkter Verhaltensbeobachtung durchgeführt. In dieser Zeit kam heraus, dass weder Tanzen noch Wiegesang in der Gemeinschaft präsent sind, obwohl alle anderen Formen von Gesang, wenn auch auf einen engen Rahmen beschränkt, regelmäßig vorkommen. Die singenden Aktivitäten beschränken sich bei den Nordlichen Aché auf einzelne erwachsene Sänger, meist Männer, die monotone oder rhythmisch gesprochene Lieder vortragen. Frauen singen selten und meist überverstorbene Angehörige in kleinen ritualisierten Lamentsingarten. Kein gemeinschaftliches Singen oder Tanzen unterstützt kollektive Rituale oder soziale Integration, und vor allem fehlt jeglicher nicht-spontaner melodischer Gesang, der dazu dient, Säuglinge zu beruhigen.
Trotz dieser Abwesenheit zeigen Eltern ein aktives Engagement in der Säuglingspflege durch Sprache und spielerische Interaktion, was andeutet, dass Wiegesang kein fehlendes Bedürfnis reflektiert. Die Gründe für den Verlust dieser kulturellen Praktiken liegen vermutlich in den dramatischen demographischen und sozialen Umwälzungen, die die Nordlichen Aché in ihrer Geschichte erfahren haben. Historische Bevölkerungsengpässe, verursacht durch Kontakt mit Außenstehenden und durch Epidemien, führten zu einem Rückgang der Bevölkerung auf wenige hundert Individuen. Solche Flaschenhälse haben weitreichende Folgen, nicht nur genetisch, sondern auch kulturell, da die Weitergabe komplexer Traditionen in kleinen Gemeinschaften erschwert wird. Ein Vergleich mit den Südlichen Aché zeigt, dass diese Nachbarn in engeren Gemeinschaften trotz Kontakt zu Missionaren Tanz und kollektive Gesänge sogar nach dem Kontakt fortführen, was die positive Rolle stabiler Kulturtransmission illustriert.
Der Verlust von Wiegesang und Tanz lässt sich nicht allein durch biologische oder psychologische Unfähigkeit erklären, da archetypische menschliche Fähigkeiten wie Lächeln und Sprache weiterhin präsent sind. Vielmehr wird deutlich, dass diese Verhaltensweisen kulturell erlernt und sozial vermittelt werden müssen. Die nordlichen Aché scheinen jahrzehntelang in einem Zustand gewesen zu sein, in dem die transgenerationale Weitergabe dieser Rituale und Künste unterbrochen war. Diese Erkenntnis stellt die bisherige Vorstellung von Kultur als unverrückbare Konstante infrage und zeigt, wie zerbrechlich selbst tief verwurzelte kulturelle Praktiken sein können. Ethnomusikologische Studien wie diese verdeutlichen auch die Notwendigkeit, die sogenannte „Universale“ menschlicher Kulturen kritisch zu prüfen.
Während Tanz und Wiegesang häufig als absolute Universale angesehen werden – als Praktiken, die in allen menschlichen Gesellschaften vorhanden sind – zeigen die Nordlichen Aché, dass selbst solche fundamentalen Ausdrucksformen aufgeben werden können. Dies fordert eine differenzierte Sichtweise, die Evolution und Kultur als in komplexer Wechselwirkung stehend anerkennt. Menschliche musikalische Fähigkeiten könnten durch genetische Prädispositionen gefördert sein, aber ihre tatsächliche Manifestation bleibt von funktionaler kultureller Weitergabe abhängig. Der Fall der Nordlichen Aché illustriert auch die Bedeutung von kultureller Komplexität und adaptiver Vielfalt innerhalb verwandter ethnischer Gruppen. Die nördlichen Aché haben mehrere kulturelle Fähigkeiten eingebüßt, darunter das traditionelle Feuermachen, komplexere religiöse Vorstellungen und vielfältigere instrumentale Musikformen, während südliche Verwandte diese Traditionen bewahrten.
Diese Divergenz unterstreicht den Einfluss von Bevölkerungsgröße, sozialer Vernetzung und historischen Ereignissen auf kulturelle Entwicklungswege. In einem größeren anthropologischen und evolutionären Kontext trägt die Erforschung der Nordlichen Aché wesentlich zum Verständnis bei, wie menschliche Kultur entsteht, sich bewährt oder verschwindet. Kulturelle Praktiken wie Tanz und Wiegesang erfüllen Funktionen, die von sozialer Bindung bis zu Säuglingsentwicklung reichen. Wenn solche Praktiken verloren gehen, sind die Gründe oft tief verwurzelt in historischen Bevölkerungsrückgängen, sozialer Umstrukturierung oder der Unterbrechung von Weitergabeprozessen. Diese Erkenntnisse rufen auch politische und ethische Überlegungen hervor, insbesondere in Bezug auf den Schutz indigener Kulturen und deren Rechte.
Die Anerkennung dessen, dass kulturelle Verluste nicht nur aus Desinteresse, sondern auch aus historischen Traumata und externem Druck resultieren, sollte zu verstärktem Engagement für kulturelle Erhaltung und Revitalisierung animieren. Missionarische und staatliche Einflüsse haben für die Aché teilweise zu neuen Formen von Musik geführt, das ursprüngliche Repertoire blieb jedoch stark eingeschränkt. Darüber hinaus werfen die Ergebnisse ein Licht auf die Bedeutung kultureller Übertragung für die Gestaltung der menschlichen Psyche. Die Fähigkeit zur musikalischen Aktivität, zum synchronisierten Bewegen und zur emotionalen Kommunikation mit Säuglingen ist möglicherweise in unseren biologischen Anlagen verwurzelt. Dennoch zeigen die Nordlichen Aché, dass diese Potentiale ohne kulturelle Praxis nicht in vollem Umfang ausgelebt werden.
Musik und Tanz als kulturelle Phänomene sind somit keine fest verdrahteten Verhaltensmuster, sondern Ergebnisse von dynamischen Prozessen kultureller Erfindung und Anpassung. Die Forschung an den Nordlichen Aché trägt zur Debatte bei, ob Musik- und Tanzuniversale als genetisch determinierte Verhaltensweisen zu sehen sind oder vielmehr als kulturelle Konstrukte, die sich je nach sozial-historischen Umständen wandeln können. Die Beobachtungen unterstützen letztere Position, wenn auch unvereinbar mit einer grundsätzlichen biologischen Veranlagung. Sie zeigen, dass evolutionäre Theorien der Musik, welche kulturelle Variabilität und Transmission berücksichtigen, einen realistischeren Rahmen bieten als strikt genetisch basierte Erklärungsmodelle. Die Nordlichen Aché bieten durch ihre isolierte und zugleich gut dokumentierte Lebensweise einen einzigartigen Blick auf den Prozess, wie kulturspezifische Verhaltensweisen entstehen, bestehen oder verloren gehen.