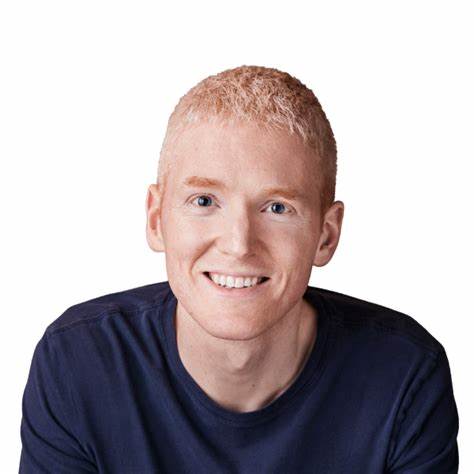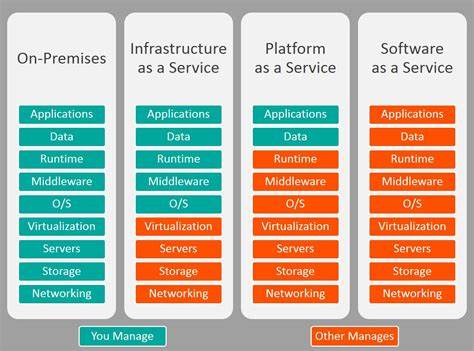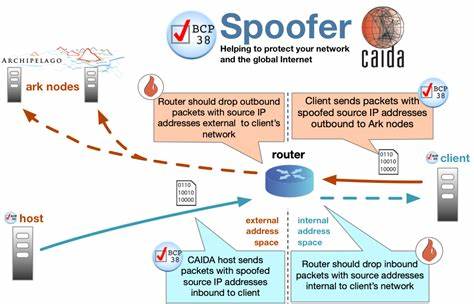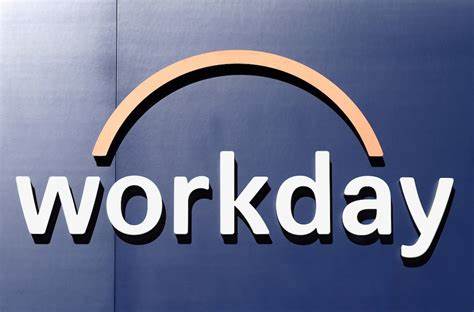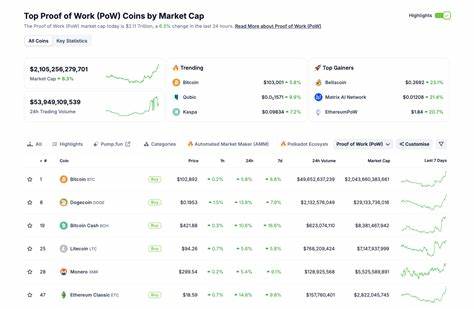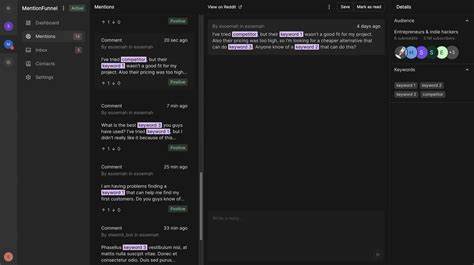Die Ziegelherstellung zählt zu den grundlegenden Wirtschaftsaktivitäten in Bangladesch und vielen anderen südasiatischen Ländern. Sie trägt maßgeblich zur urbanen Entwicklung und zum Wohnungsbau bei. Doch trotz ihrer wirtschaftlichen Bedeutung wird die industriebedingte Umweltbelastung häufig unterschätzt. Traditionelle Ziegelöfen verbrennen große Mengen an Kohle und anderen fossilen Brennstoffen, wobei sie erhebliche Mengen an Kohlendioxid (CO2), Feinstaub (PM2.5) und weitere Schadstoffe freisetzen.
Diese Emissionen stellen nicht nur eine ernsthafte Gefahr für die Umwelt dar, sondern beeinträchtigen auch die Gesundheit der Bevölkerung und die Produktivität der Landwirtschaft. In einem Land wie Bangladesch, das sich durch eine hohe Bevölkerungsdichte und eingeschränkte Überwachungsstrukturen auszeichnet, nimmt das Problem eine besonders dringliche Bedeutung an. Hier setzt eine aktuelle Studie an, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener internationaler Institutionen, darunter die Boston University School of Public Health, Stanford University und das International Centre for Diarrhoeal Disease Research in Bangladesh (icddr,b), gemeinsam durchgeführt haben. Die Studie konzentriert sich auf praktikable, gewinnorientierte Anpassungen in den Betriebsabläufen der Ziegelindustrie, die ohne strikte gesetzliche Auflagen umgesetzt werden können. Durch ein umfassendes Trainings- und Unterstützungsprogramm konnten Betreiber von 276 Ziegelöfen im Verlauf einer Saison motiviert werden, effizientere und sauberere Arbeitsweisen anzuwenden.
Im Mittelpunkt der Intervention standen einfache, aber wirkungsvolle Maßnahmen. Dazu zählt eine verbesserte Stapeltechnik der Ziegel, die dafür sorgt, dass der Brennraum im Ofen besser genutzt und die Verbrennung optimiert wird. Ferner wurde der Einsatz von mit einer Maschine aufbereitetem Biomassebrennstoff gefördert, der die vollständige Verbrennung begünstigt und den Verlust von Wärmeenergie reduziert. Dadurch sinkt der Brennstoffverbrauch erheblich, was sich in einer spürbaren Reduzierung der CO2- und Feinstaubemissionen niederschlägt. Die Ergebnisse der Studie belegen, dass 65 Prozent der Ofenbesitzer die empfohlenen Änderungen implementierten.
Diese führten zu einer Reduktion des Energieverbrauchs um 23 Prozent. Gleichzeitig gingen die Emissionen von Kohlendioxid und Feinstaub um etwa 20 Prozent zurück. Diese Zahlen sind nicht nur aus ökologischer Sicht beeindruckend, sondern zeigen auch den wirtschaftlichen Mehrwert für die Betreiber: Geringerer Kohleverbrauch bedeutet niedrigere Betriebskosten und höhere Gewinnmargen. Zudem produzieren die optimierten Verfahren qualitativ hochwertigere Ziegel, die auf dem Markt höhere Preise erzielen können. Ein weiteres beachtenswertes Ergebnis ist die Nachhaltigkeit der Maßnahmen.
Im Folgejahr wurde festgestellt, dass die Adoption der neuen Praktiken nicht nur erhalten blieb, sondern sich sogar verstärkte. Dies spricht für die Akzeptanz und den praktischen Nutzen der Innovation bei den Anwendern. Die Betreiber zeigten sich offen für Veränderungen, sofern diese mit ihrem finanziellen Interesse im Einklang standen und die Umsetzung keine übermäßigen technischen Hürden darstellte. Die Bedeutung dieser Studienergebnisse liegt auch darin, dass frühere Regulierungsversuche in Bangladesch oft auf geringe Durchsetzungskraft stießen. So existieren bereits Vorschriften, die unter anderem die Nutzung von Feuerholz verbieten oder Ziegelöfen von sensiblen Einrichtungen wie Schulen und Krankenhäusern fernhalten sollen.
Dennoch sind viele Öfen illegal oder in unmittelbarer Nähe dieser Orte angesiedelt, was das Gesundheitsrisiko für Tausende von Menschen erhöht. Die neuen, freiwilligen und wirtschaftlich motivierten Maßnahmen bieten daher eine pragmatische Alternative, die ohne starke staatliche Eingriffe Wirkung zeigt. Die Umsetzung der Verbesserungen war jedoch nicht ohne Herausforderungen. In einigen Fällen waren die Ofenbesitzer skeptisch, ob die Veränderungen technisch realisierbar und für ihre Arbeiter praktikabel seien. Besonders die Arbeitsbedingungen und die Motivation der Beschäftigten wurden als kritische Faktoren identifiziert.
Die Forscher betonen deshalb, dass zukünftige Anstrengungen neben technischen Neuerungen auch die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den Fokus nehmen sollten, um nachhaltige Resultate zu erzielen. Ein weiteres zentrales Potenzial der Studie besteht in der Skalierbarkeit der Intervention. Die Ziegelherstellung ähnelt sich in vielen Teilen Südasiens, beispielsweise in Indien und Nepal. Dort könnten vergleichbare energieeffiziente Praktiken mit vergleichbaren positiven Effekten eingeführt werden. Die dabei entstehenden sozialen und ökonomischen Vorteile sind enorm, da verweigerte Innovationen in dieser Branche seit Langem ein großes Problem darstellen.
Auch über den Ziegelsektor hinaus könnten die gewonnenen Erkenntnisse Anregungen für andere informelle und emissionsintensive Industrien liefern. Die Verknüpfung von praktischen Anwendungswissen, wirtschaftlicher Motivation und lokaler Einbindung der Akteure zeigt, wie wirtschaftliches Wachstum und Umweltschutz kein Widerspruch sein müssen. Vielmehr können sie Hand in Hand gehen, wenn geeignete Rahmenbedingungen geschaffen und Wissen gezielt vermittelt wird. Angesichts der globalen Herausforderungen durch den Klimawandel und der Dringlichkeit, Treibhausgasemissionen zu reduzieren, erlangt auch die Rolle kleiner und mittelgroßer Industrien wie der Ziegelherstellung große Bedeutung. Die Studie liefert dafür wertvolle Hinweise, wie durch einfache und kostengünstige Anpassungen erhebliche Mengen von CO2 und gesundheitsgefährdendem Feinstaub eingespart werden können – mit unmittelbaren positiven Auswirkungen für die Menschen vor Ort.