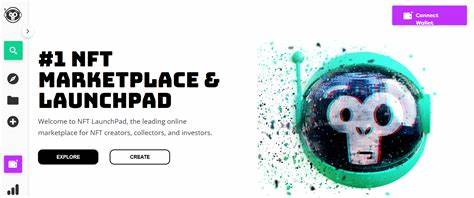Das Bild von Bogenschützen, die in eindrucksvoller Manier gemeinsam auf Kommando ihre Pfeile abfeuern und so eine undurchdringliche Arrow-Volleyschicht erzeugen, ist ein vertrautes Motiv in Filmen und Fernsehserien. Szenen wie diese lassen das Publikum oft die Effektivität und den dramatischen Impact der Pfeilregennutzung bewundern. Doch so spektakulär diese Darstellungen auch sind, mit der tatsächlichen Geschichte und den realen Kampftaktiken haben sie wenig zu tun. Schon aus physischer und taktischer Sicht erscheint das Konzept eines koordinierten, gleichzeitigen Abschusses von Pfeilen durch eine Gruppe von Bogenschützen in der prämodernen Kriegsführung wenig sinnvoll. Anders als bei Feuerwaffen, die aufgrund ihres langsamen Nachladeprozesses enorm davon profitieren können, wenn sich mehrere Soldaten koordinieren und ihre Schüsse gleichzeitig abgeben, sahen sich Bogenschützen anderen Einschränkungen gegenüber.
Zunächst ist zu beachten, dass klassische Kriegspfeile mit Lang- oder Recurved-Bögen schnell hintereinander abgeschossen werden konnten. Ein ausgebildeter Bogenschütze war in der Lage, etwa sechs oder mehr Pfeile pro Minute abzufeuern. Angesichts dieser relativ hohen Feuerrate entstand keine effektive Lücke, die durch eine koordinierte Schussabgabe geschlossen werden müsste. Somit bot das Warten auf den genau richtigen Moment und die Synchronisierung aller Schüsse keinen taktischen Vorteil. Das Halten des Bogens im vollen Auszug, also die Position, in der der Pfeil abgeschossen wird, ist physisch äußerst anstrengend, besonders bei Kriegslangbögen mit Zuggewichten von bis zu über 130 Pfund.
Das konstante Bereithalten bis zum Einsetzen eines Sammelkommandos führte zu rascher Erschöpfung der Schützen. Viel effizienter und praktikabler war es für die Bogenschützen, ihre Pfeile spontan und so schnell wie möglich hintereinander abzuschießen, anstatt alle gleichzeitig loszulassen. Diese Technik ermöglichte eine gleichmäßige und andauernde Regenwirkung, die sich in einer kontinuierlichen Pfeilwolke niederschlug. Darüber hinaus ist der Begriff „Volleyschuss“ in erster Linie eine Antwort auf deren schussbedingte Nachladezeiten von Feuerwaffen. Bei Musketen und frühen Arkebusen dauerte das Nachladen oftmals 20 bis 30 Sekunden oder länger.
Um dabei keine tödliche Feuerlücke zu erzeugen, entwickelten Militärs für diese Waffen Salventaktiken. Beim sogenannten Gegenzugschuss etwa feuerten die vordersten Reihen gleichzeitig, um sich dann in den Reihen zurückzuziehen und nachzuladen, während es den hinteren Reihen ermöglicht wurde, nacheinander zu schießen, was eine nahezu ununterbrochene Feuerlinie gewährleistete. Bei Bögen entfiel dieses Problem gänzlich. Das Nachladen nach dem Schuss ist eine schnelle, wiederholbare Bewegung. Bereits wenige Momenten nach einem Schuss konnte der Bogenschütze einen weiteren Pfeil auflegen und abfeuern.
Diese fundamental andere Mechanik der Waffe machte ein koordinierter und gemeinsamer Schuss nahezu überflüssig, wenn nicht sogar kontraproduktiv. Auch aus Sicht der Effektivität des Pfeilhagels spielten koordiniert abgefeuerte Pfeil-Salven keine entscheidende Rolle. Im realen Gefecht waren die meisten Pfeile weit davon entfernt, massiven Schaden anzurichten oder ganze Reihen im Feind zu durchbrechen. Die meisten Pfeile gingen schlichtweg ins Leere, da zwischen den Soldaten genug Platz war und sie sich zudem hinter Schilden und Rüstungen gut schützen konnten. Die klassische Schildwand beispielsweise reduzierte die Trefferfläche massiv, sodass die getroffenen Pfeile selten lethale Verletzungen verursachten.
Die Überlebenden waren durch die Anzahl und Dichte der feindlichen Pfeile zwar oftmals erschöpft, verwirrt oder verletzt, aber der Durchbruch durch eine geschickte Formation gelang erst im Nahkampf mit Körperwaffen. Auch für eine simultane Salve wäre wegen der tendenziell großen Streuung der Pfeile keine besonders gefährliche Aufprallkonzentration zu erwarten gewesen. Anders als bei Schusswaffen, deren Projektile schwerer und kinetisch wesentlich energiegeladener sind, haben Pfeile eine erheblich geringere Durchschlagkraft. Ihre Wirkung war eher kumulativ und dauerte über eine längere Zeit an. Um eine Linie nennenswert zu schwächen, bedurfte es daher eines kontinuierlichen und präzisen Hagels über mehrere Minuten oder sogar Stunden, nicht eines einzelnen, einmaligen Massenschusses.
Ein weiterer Punkt, der gegen eine koordinierte Pfeil-Salve sprach, war das Fehlen schriftlicher und praktischer Belege für eine solche Taktik in historischen Quellen. Während viele antike und mittelalterliche Texte Übungen, Kommandos oder Formationsbeschreibungen zu Fernwaffen enthalten, finden sich für Bögen keine Hinweise auf systematische Volleyschüsse. Das ist in starkem Kontrast zu Feldanweisungen für Feuerwaffen und auch für chinesische Kreuzbogenschützen, die tatsächlich sehr wohl Salventaktiken anwendeten, um den langen Nachladeprozess ihrer Waffen auszugleichen. Neben den technischen und taktischen Überlegungen entwickelte sich auch im kulturellen und philosophischen Kontext ein Bild von Soldaten als „ein Teil des Ganzen“, etwa in der frühen Neuzeit mit dem Aufkommen stehender Heere, die in strikter Formation und strenger Disziplin operierten. Diese Sicht machte die Koordination von Feuerschüssen möglich und sinnvoll.
Solche Denkweisen fehlen in älteren Epochen, wenn man an die individuelle Initiative und die weniger mechanisierten Feldformationen antiker und mittelalterlicher Heere denkt. Der Film und die Populärkultur dagegen übertragen allzu oft das bekannte Bild der Feuerwaffenschlacht auf Schauplätze und Zeitperioden, in denen das schlicht nicht passte. Regisseure nutzen gerne den dramatischen Effekt eines synchron abgefeuerten Pfeilhagels, der ganze Armeen niederstreckt, was in der Realität aber nicht realistisch darstellbar ist. Dieses Stilmittel wurde zum Teil erst populär, als filmische Darstellungen von Schlachten im 18. und 19.
Jahrhundert erlebt und verinnerlicht wurden, und wird heute automatisch auf frühere Zeiten übertragen – eine anachronistische Verklärung. Abschließend lässt sich sagen, dass historisch belegte Bogenschützen eher ständig und individuell schossen, indem jeder Schütze seinen eigenen Rhythmus fand und die Stärken seines Bogens sowie seiner körperlichen Kondition nutzte. Die Vorstellung eines gemeinsam koordinierten Salvenfeuers passt weder in die physischen Möglichkeiten der Bogenschützen noch in die taktischen Gegebenheiten vor der Feuerwaffenära. Die wahre Wirkung der Pfeilregengeschehnisse lag im dauerhaften, über einen längeren Zeitraum anhaltenden Druck und der Erschöpfung der Gegner und nicht im rücksichtslos alles gleichzeitig Niedermähen durch einen einzigen Schussbefehl. Vor diesem Hintergrund können moderne Filmemacher und Geschichtenerzähler von einer realistischeren Darstellung profitieren, die sowohl die physiologische Belastung der Bogenschützen als auch die taktische Realität und die relative Wirkung von Pfeilfeuer berücksichtigt.
Die Herausforderung besteht darin, die Faszination und Dramatik archaischer Schlachtszenen ohne unrealistische und fehlleitende Elemente wie das Salvenfeuer zu bewahren, und so ein authentischeres Bild der Kriegsführung zu vermitteln.




![Mojo: Modular's unified device accelerator language [video]](/images/C923D0E5-C429-4CEB-AB7B-AFAE96FD6A43)