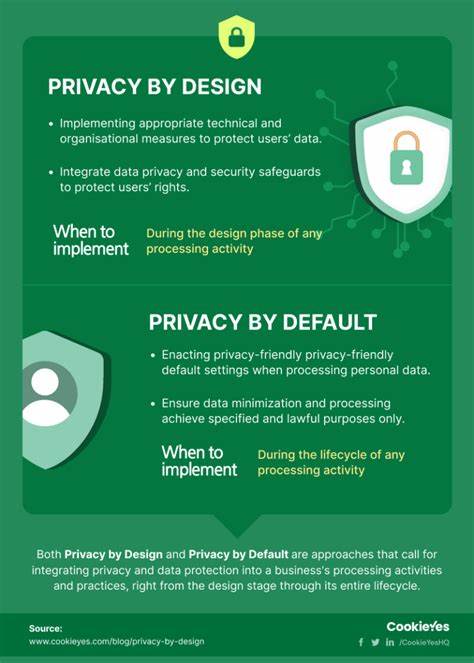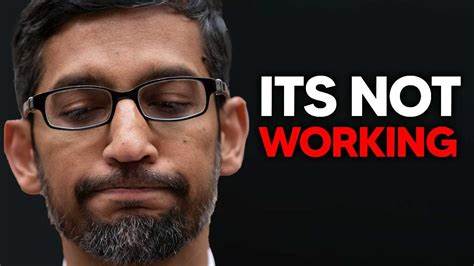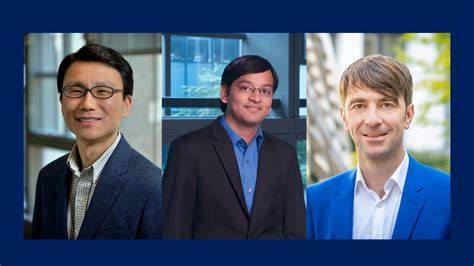Seit Jahrzehnten geprägt Hollywoods Filmindustrie das Bild der künstlichen Intelligenz (KI) als Bedrohung für die Menschheit. Von Klassikern wie "2001: Odyssee im Weltraum" über „Terminator“ bis hin zu „Ex Machina“ wird KI meist als eine Kraft dargestellt, die Menschen gefährdet oder gar vernichten will. Auch wenn einzelne Filme wie Steven Spielbergs „A.I.: Künstliche Intelligenz" Hoffnung vermitteln, verbindet das Publikum mit künstlicher Intelligenz häufig eher Szenarien, in denen sie sich gegen ihre Schöpfer richtet oder die Welt in Chaos stürzt.
Aus dieser kulturellen Prägung heraus entstehen Sorgen und Missverständnisse, die gerade in Zeiten rasanter technischer Fortschritte eine besondere Brisanz besitzen. Vor allem Google, als einer der weltweit führenden Entwickler im Bereich der künstlichen Intelligenz, hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen dramatischen Blick zu verändern. Das ambitionierte Ziel ist es, KI als ein Werkzeug zu zeigen, das vor allem Chancen bietet und in dem der Mensch eine zentrale Rolle behält. Die Initiative mit dem Titel „AI on Screen“, die Google gemeinsam mit Range Media Partners aus Santa Monica ins Leben gerufen hat, verfolgt genau diesen Zweck: Neue filmische Perspektiven auf KI schaffen, welche die Technologie nicht einseitig als Bedrohung zeigen, sondern komplexe, menschlich geprägte Geschichten erzählen. Range Media Partners, eine Agentur, die Schauspieler, Autoren und Produzenten betreut, produziert im Rahmen dieser Zusammenarbeit Kurzfilme, die jeweils rund 15 bis 20 Minuten lang sind.
Bislang wurden zwei Projekte grünes Licht gegeben. „Sweetwater“ erzählt von einem Mann, der in sein Elternhaus zurückkehrt und einen holografischen Abdruck seiner verstorbenen Mutter entdeckt – eine Figur, die von einer echten Hollywoodgröße dargestellt wird, Regie führt Michael Keaton, der damit erstmals gemeinsam mit seinem Sohn Sean Douglas arbeitet, der das Drehbuch schrieb. Der zweite Kurzfilm „Lucid“ befasst sich mit einem Pärchen, das in einer bedrückenden Realität gefangen ist und alles aufs Spiel setzt, um mithilfe eines Geräts einen gemeinsamen Traum zu erleben. Diese Geschichten thematisieren subtil die Schnittstellen zwischen Menschlichkeit und Technologie, ohne dabei in einfache Schwarz-Weiß-Urteile zu verfallen. Stattdessen laden sie Zuschauer ein, über ethische Dilemmata und emotionale Verbindungen nachzudenken, die sich aus der Integration von KI im Alltag ergeben.
Hinter dem Ansatz steht die Erkenntnis, dass die öffentliche Wahrnehmung von KI in den USA und weltweit ambivalent ist. Eine Umfrage aus dem Jahr 2024 von Bentley University und Gallup zeigt, dass über die Hälfte der Befragten künstliche Intelligenz als eine Technologie sieht, die sowohl Chancen als auch Risiken birgt, während knapp ein Drittel sie eher negativ bewertet. Gerade deshalb ist es bedeutend, wie KI in der Popkultur dargestellt wird – denn Filme und Serien prägen Bewusstsein und Einstellungen für breite Bevölkerungsgruppen. Google nimmt eine Schlüsselrolle ein, um mit diesem kulturellen Wandel voranzugehen und Ängste gegenüber künstlicher Intelligenz abzubauen. Das Unternehmen betont, dass es bei diesen Filmprojekten nicht um Werbung für eigene Produkte gehe, sondern um das Erzählen vielschichtiger, menschlicher Geschichten.
Die Beteiligten haben Zugang zu Experten von Google, um sicherzugehen, dass die Technologie realistisch dargestellt wird. Dabei geht es um Fragen wie: Welche Innovationen existieren tatsächlich? Wie funktionieren sie? Welche gesellschaftlichen Konsequenzen haben sie? Zudem gibt die Initiative Raum, die emotionalen und sozialen Dimensionen von KI zu erkunden, also wie Menschen künftig mit intelligenten Technologien interagieren und sich auf sie einlassen können. Aktuell befindet sich die Filmindustrie in einer Spannungsphase hinsichtlich der KI-Entwicklung. Die Debatten um Rechte, Authentizität und Arbeitsplätze prägen die Szene. So sorgten die Streiks von Drehbuchautoren und Schauspielern 2023 in Hollywood auch wegen der Sorge über KI-Anwendungen für Aufsehen.
Künstler fürchten, dass ihre Stimmen, Gesichter und Werke ohne Zustimmung reproduziert und kommerziell genutzt werden. Unternehmen und Kreative suchen daher nach Lösungen für faire Regeln und Transparenz. Gleichzeitig könnten negative Schlagzeilen und ein populäres Misstrauen vor KI zu juristischen Nachteilen führen. In solchen Situationen helfen Geschichten, die Brücken bauen, Verständnis fördern und den Diskurs versachlichen. Darüber hinaus gehen Google und weitere Tech-Firmen wie OpenAI, Meta und Anthropic aktiv auf Filmschaffende zu, um ihre KI-Werkzeuge vorzustellen und kreative Partnerschaften zu fördern.
So arbeitet Meta beispielsweise mit Horrorstudio Blumhouse zusammen, das durch Filme wie „M3GAN“ das Spannungsfeld zwischen KI-Faszination und -Furcht thematisiert. Google kooperiert auch mit Regisseur Darren Aronofsky, um weitere Kurzfilme zu unterstützen und den Einsatz von KI-Tools in der Filmproduktion auszuprobieren. Die Technologie ermöglicht unter anderem eine Kostensenkung und neue kreative Freiräume, was gerade in einer Filmbranche, die unter wirtschaftlichen Herausforderungen leidet, einen wichtigen Faktor darstellt. Auch in Museen und Ausstellungen wird artificial intelligence für das Publikum zunehmend greifbar gemacht. Anthropic etwa sponsort die Ausstellung „Adventures in AI“ im Exploratorium in San Francisco, die zum Nachdenken über die Chancen und Risiken von KI einlädt und Besucher spielerisch mit verschiedenen KI-Modellen interagieren lässt.
Solche Initiativen sollen die Distanz zwischen Allgemeinbevölkerung und komplexer Technik verringern und einen reflektierten Umgang fördern. Trotz aller Bemühungen, KI differenzierter und positiver darzustellen, dominieren in der populären Kultur weiterhin düstere Visionen. Aktuelle Horrorfilme wie „M3GAN“ oder „Afraid“ erzählen Geschichten von aus dem Ruder gelaufener künstlicher Intelligenz und sprechen damit Ängste an, die viele Zuschauer fesseln. Der Erfolg solcher Filme zeigt, dass gesellschaftliche Zweifel und dramatische Szenarien auch weiterhin Stoff für kreative Erzählungen liefern. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Verhältnis zwischen Technologie, Kunst und Publikum in den kommenden Jahren entwickelt.
Die von Google initiierte Filmschmiede „AI on Screen“ ist aber ein bemerkenswerter Schritt, um das Bild von KI zu diversifizieren und die Debatte vom reinen Untergangsszenario hin zu einer ausgewogeneren, menschlicheren Perspektive zu lenken. Wer die Zukunft mitgestalten will, muss solche kulturellen Narrative verstehen und mitgestalten. Künstliche Intelligenz wird in unserem Alltag zunehmend präsenter sein, und wie wir sie wahrnehmen, wird entscheidend beeinflussen, wie wir mit der Technologie umgehen. Google und Hollywood zeigen gemeinsam, dass es möglich ist, Geschichten zu erzählen, die nicht nur faszinieren, sondern auch Ängste abbauen und neugierig machen – ein Erfolg für Kultur und Technik zugleich.