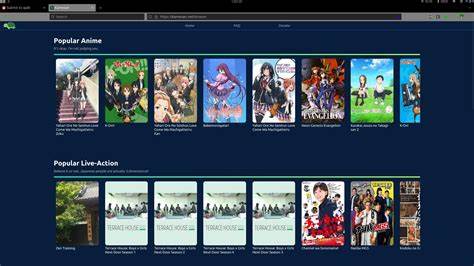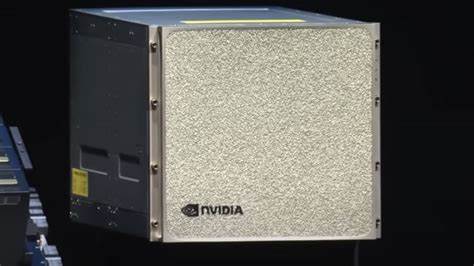Europas Kapitalmärkte stehen seit Jahrzehnten vor einer grundlegenden Herausforderung: Sie sind fragmentiert und ineffizient, trotz vieler Reformversuche und ambitionierter Pläne zur Integration. Die Vision einer echten Kapitalmarktunion, die es jedem europäischen Sparer ermöglicht, problemlos in Unternehmen aus dem ganzen Kontinent zu investieren, blieb bislang unerfüllt. Stattdessen dominieren zahlreiche nationale Regulierungen, widersprüchliche Vorschriften und die starke Bankenzentralität das Bild. Doch warum ist das so, und wie kann Europa den Weg zu einem vernetzten, dynamischen Kapitalmarkt finden, der Innovation und Wachstum fördert? Die aktuelle Situation in Europas Finanzlandschaft ist von einer starken Abhängigkeit von Banken geprägt. Dabei horten private Haushalte in der EU erhebliche Mittel, sparen durchschnittlich rund 15 Prozent ihres Einkommens und verfügen über Ersparnisse in Milliardenhöhe.
Dennoch fließen diese Gelder vielfach nicht dorthin, wo sie am effektivsten eingesetzt werden könnten – beispielsweise in junge, innovative Start-ups oder wachstumsstarke Unternehmen. Ein Großteil des Kapitals liegt stattdessen auf Bankeinlagen oder gelangt durch Bankvermittler in konservative, oft wenig renditestarke Anlagen. Diese Verwurzelung der Finanzlandschaft in der Bankenwelt erschwert den Zugang zu alternativen Finanzierungsquellen wie Eigenkapital oder risikoreichen Investments. Ein zentrales Hemmnis stellen die nationalen Regulierungen dar, die nach wie vor für jedes Land unterschiedliche Anforderungen an Unternehmen, Investoren und Finanzintermediäre festlegen. Wenn ein Start-up aus Spanien beispielsweise Kapital von einem deutschen Pensionsfonds oder einer niederländischen Familie aufnehmen möchte, muss es komplexe nationale Vorschriften in gleich mehreren Ländern einhalten.
Diese Hürden erhöhen nicht nur die Kosten und Risiken sondern wirken auch abschreckend auf Investoren und Unternehmer. Infolgedessen lagerten viele vielversprechende Unternehmen ihren Hauptsitz ins Ausland aus, vor allem nach Nordamerika. Die Folge ist eine Abwanderung von Talenten und Kapital, die Europas Innovationskraft schwächt. Die Geschichte der europäischen Bemühungen um eine Kapitalmarktunion reicht über sechzig Jahre zurück. Frühere Untersuchungen und Berichte, von denen viele bereits in den 1960er Jahren begannen, legten die komplizierte und fragmentierte Natur der EU-Finanzmärkte offen – eine Vielfalt nationaler Regulierungen, die sich teilweise sogar widersprechen.
Trotz diverser Initiativen, wie dem 2015 eingeführten Vorschlag zur Kapitalmarktunion, wurden bis heute nur begrenzte Fortschritte erreicht. Zwar wurden einige Erleichterungen bei grenzüberschreitenden Börsenzulassungen und Fondverkäufen eingeführt und teilweise Crowdfunding-Pässe geschaffen. Doch ist das in keinem Verhältnis zu den Notwendigkeiten, um die Kapitalmarktintegration tatsächlich spürbar voranzutreiben. Ein Grund für die schleppenden Änderungen ist die politische und wirtschaftliche Macht, die Banken in Europa innehaben. Sie kontrollieren viele Vertriebskanäle für Finanzprodukte und dominieren den privaten Vermögensmarkt.
In Ländern wie Rumänien oder Portugal gehen über 90 Prozent der Fonds über Banken – in Spanien, Deutschland und Italien sind es ähnlich hohe Werte. Banken besitzen die „Regalplätze“, auf denen Fonds angeboten werden, und verlangen hohe Gebühren dafür. Diese Mechanismen führen dazu, dass teure, wenig effiziente Produkte privilegiert werden, während günstige Indexfonds oder alternative Investments im Verborgenen bleiben. Darüber hinaus schützen nationale Interessen und Lobbys das etablierte Bankensystem und wehren Regulierungsänderungen ab, die ihre dominierende Stellung infrage stellen könnten. Zudem tragen Verbraucherschutzbestimmungen und steuerliche Rahmenbedingungen, wie die französische Assurance-vie oder die deutschen Riester-Renten, dazu bei, dass Anleger an bankengebundene Produkte gebunden bleiben.
Solche sogenannten „Tax-Wrappers“ bieten zwar steuerliche Vorteile, erschweren jedoch den Wechsel zu alternativen Investitionen und binden Kapital in festen Strukturen. Daraus resultiert eine starke Fragmentierung und eingeschränkte Mobilität von Kapital im gesamten EU-Binnenmarkt. Auf politischer Ebene zeigt sich der Widerstand gegen tiefgreifende Reformen auch in der Haltung der Mitgliedsstaaten. Nationalregierungen schätzen starke inländische Banken, die in Krisenzeiten als wichtiges Instrument für Stabilität und Steuerungsmöglichkeiten dienen. Dies führt dazu, dass im Europäischen Rat sowie in ökonomischen Gremien wie ECOFIN oft Kompromisse erzielt werden, die den Status quo erhalten oder nur geringe Verbesserungen bewirken.
Die Folge ist eine langsame Harmonisierung, die den Banken mehr Effizienz im bestehenden System verschafft, statt echte Alternativen wie direkte Kapitalmarktfinanzierung oder einheitliche EU-Regelwerke zu fördern. Im internationalen Vergleich zeigt sich, dass andere Regionen deutlich erfolgreicher darin waren, fragmentierte Märkte zusammenzuführen. Beispielsweise haben die USA mit dem National Securities Markets Improvement Act (NSMIA) von 1996 einen entscheidenden Schritt getan. Statt zu versuchen, die einzelnen Staatengesetze zu harmonisieren, schuf das Gesetz einen einheitlichen Bundesstandard, der private Kapitalangebote von den meisten Einzelstaatengesetzen befreite. Das bewirkte einen enormen Wachstumsschub im privaten Beteiligungskapitalmarkt.
Unternehmen wurden damit um ein Vielfaches attraktiver für Investoren, und die Mittelaufbringung wurde deutlich einfacher und größer. Europa könnte von einem ähnlichen Konzept profitieren, indem es statt weiterer komplizierter Abstimmungsprozesse einen sogenannten „28. Regime“-Ansatz einführt. Diese Option ermöglicht einen EU-weiten, optionalen Rechtsrahmen für Unternehmens-, Wertpapier- und Insolvenzrecht, den Unternehmen anstelle der nationalen Regelungen wählen können. Ein solches flexibles System würde Investoren einen klareren, sicheren und grenzüberschreitenden Zugang ermöglichen, während nationale Systeme unberührt blieben.
Dieser Weg bietet einen Kompromiss zwischen den Interessen der Mitgliedsstaaten und der Notwendigkeit eines funktionierenden Kapitalmarktes. Neben der rechtlichen Vereinfachung sind aber auch kulturelle und strukturelle Anpassungen erforderlich. Investoren müssen für alternative Anlageformen sensibilisiert und besser informiert werden. Finanzielle Bildung, transparente Produkte und einfache Verfahren tragen dazu bei, dass Kapital effizienter zwischen Sparer und Unternehmer fließen kann. Die EU-Kommission setzt mit ihren jüngsten Vorschlägen zur „Savings and Investment Union“ auf Maßnahmen wie steuerliche Anreize, Automatisierung bei der Altersvorsorge, verbesserte Zulassungsprozesse für Unternehmen an Börsen und mehr Verbriefungen von Krediten.
Doch diese Schritte sind eher inkrementell und können das grundsätzliche Ungleichgewicht zugunsten der Banken nur bedingt aufbrechen. Es bleibt die Frage, ob Europas politische Führung den Mut aufbringt, weitreichendere Reformen anzugehen, die den bestehenden Interessenkonflikten zuwiderlaufen. Die potenziellen Gewinne sind groß: Eine effektivere Kapitalallokation könnte die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen steigern, die Innovationsfähigkeit fördern und Europas Position im globalen Finanz- und Technologiewettbewerb stärken. Zudem könnten mehr Investitionen in nachhaltige und zukunftsorientierte Sektoren fließen, was angesichts der aktuellen ökologischen Herausforderungen wichtiger denn je ist. Abschließend lässt sich sagen, dass die Fragmentierung der europäischen Kapitalmärkte ein komplexes Zusammenspiel aus historischen, politischen und ökonomischen Faktoren widerspiegelt.




![I made a custom ASIC: first of its kind [video]](/images/66C0D5C4-8C06-42AA-AD7B-C94C320DDABD)