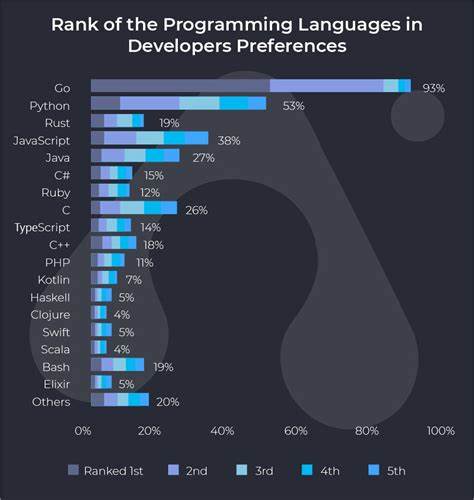Die Sahara ist heute als die größte heiße Wüste der Welt bekannt, geprägt von extremer Trockenheit und lebensfeindlichen Bedingungen. Doch vor mehreren tausend Jahren sah dieses Gebiet ganz anders aus. Zwischen etwa 14.500 und 5.000 Jahren vor unserer Zeitrechnung war die Sahara während der sogenannten Afrikanischen Feuchtperiode eine grüne, lebendige Savanne mit Flüssen, Seen und vielfältiger Vegetation.
Dieses Klima ermöglichte es menschlichen Populationen, sich in der Region niederzulassen und neue Lebensweisen wie die Viehzucht zu entwickeln. Bis vor Kurzem war jedoch wenig über die genetische Herkunft jener frühen Bewohner der Grünen Sahara bekannt, da die Preservation von DNA in solch extremen Umgebungen eine Herausforderung darstellt. Neue bahnbrechende Forschungen haben nun an zwei etwa 7.000 Jahre alten Individuen aus dem Takarkori-Felsunterstand im westlichen Libyen die erste tiefgreifende Analyse antiker Genome aus der Zentral-Sahara ermöglicht und liefern damit bisher ungeahnte Erkenntnisse über die menschliche Geschichte Nordafrikas. Die entdeckten Genome der beiden weiblichen Individuen, die in Takarkori gefunden wurden, zeichnen sich durch eine besondere genetische Signatur aus.
Sie stammen von einer bislang unbekannten, alten nordafrikanischen Abstammungslinie ab, die sich schon sehr früh von den Linien sub-saharischer afrikanischer Populationen abgespalten hat. Bemerkenswert ist, dass diese Linie ungefähr zeitgleich mit den Volksgruppen entstanden ist, die außerhalb Afrikas lebten. Entscheidend ist, dass diese Population offenbar über viele Jahrtausende überregional isoliert blieb und nur geringe genetische Vermischungen mit anderen Gruppen aufwies. Ein enger genetischer Zusammenhang besteht zu den 15.000 Jahre alten Jägern und Sammlern vom Taforalt-Höhlenfundort im heutigen Marokko, die mit der sogenannten Iberomaurusischen Kultur verbunden sind.
Diese Kultur ist die älteste bekannte ihrer Art in Nordafrika und belegt eine lange Kontinuität menschlicher Anwesenheit in der Region bereits vor der Afrikanischen Feuchtperiode. Die genetischen Analysen zeigen zudem, dass sowohl die Takarkori-Fossilien als auch die Iberomaurusianer eine ähnliche Distanz zu sub-saharischen afrikanischen Populationen aufweisen. Diese Tatsache unterstreicht, dass während der feuchten Phase der Sahara nur wenig genetischer Austausch über die vermeintlich grünen und durchlässigen Grenzen der Sahara hinweg stattfand. Ebenfalls auffällig ist der vergleichsweise geringe Anteil an Neandertaler-DNA in den Takarkori-Genomen. Während Nicht-Afrikaner im Allgemeinen einen bestimmten Anteil an Genabschnitten von Neandertalern geerbt haben, weisen die Takarkori-Femalen einen zehnfach geringeren Neandertaler-Anteil auf als beispielsweise frühneolithische Gruppen aus dem Nahen Osten.
Zugleich besitzt ihr Erbgut etwas mehr Neandertaler-DNA als zeitgenössische sub-saharische Bevölkerungen. Dies verweist auf eine sehr frühe Vermischung der nordafrikanischen Linie mit Populationen außerhalb Afrikas und unterstützt die These, dass sich diese Bevölkerung in Nordafrika überwiegend isoliert entwickelte. Archäologische Befunde aus dem Takarkori-Felsunterstand belegen, dass die dortigen Menschen in der mittleren Jungsteinzeit (Paulustriale Neolithikum) sesshaft waren und bereits Viehzucht betrieben. Doch der genetische Datensatz offenbart, dass der Übergang zur pastoralistischen Lebensweise im zentralen Sahara-Raum vor allem durch kulturelle Diffusion geschah, also durch die Weitergabe von Wissen und Techniken, und nicht durch großflächige Wanderungsbewegungen neuer Menschengruppen. Dies widerspricht älteren Hypothesen, die eine massive Populationseinwanderung aus dem Nahen Osten als Hauptursache für die Verbreitung der Viehzucht in der Sahara annehmen.
Die Forschungen zeigen ferner, dass sich die Grünschwämme der Saharazonen vor 7.000 Jahren genetisch eng an die populären Iberomaurusier anlehnten und damit eng mit den westlichen nordafrikanischen Jägern und Sammlern und frühen Bauern verbunden waren. Durch die Analyse von mitochondrialer DNA, die über mütterliche Linien weitergegeben wird, konnte bestätigt werden, dass die Haplogruppe N bei den Takarkori-Frauen auf eine der ältesten außerhalb von Subsahara-Afrika vertretenen Linien zurückgeht. Die Altersbestimmung dieser mitochondrialen Abstammungslinie liegt bei über 60.000 Jahren und bestätigt eine sehr alte, kontinuierliche Besiedlung Nordafrikas mit eigenständiger genetischer Entwicklung.
Eine spannende Erkenntnis ergibt sich aus der genetischen Analyse der vorgängigen Taforalt-Population, die bislang als Mischung zwischen Levantinern und einer unbestimmten sub-saharischen Herkunft galt. Die aktuellen Resultate verfeinern dieses Modell: Demnach besteht die genetische Struktur der Taforalt-Gruppe zu rund 60 Prozent aus einer Levantiner-ähnlichen Herkunft und zu etwa 40 Prozent aus einer tiefsitzenden nordafrikanischen Linie, die ihre stärksten Spuren heute in den Takarkori-Fundstellen findet. Diese Tatsache legt nahe, dass der größte Teil der genetischen Substanz der frühen Nordafrikaner lokal verwurzelt und eigenständig entstand, ohne wesentlichen Einfluss aus dem subsaharischen Afrika oder großflächigen Migrationsbewegungen während der Feuchtphase. Die grüne Sahara war in ihrer Ausdehnung nicht homogen, sondern bestand aus verschiedenen Ökozonen mit vielfältigen Landschaftsformen - Savannen, Wälder, Wasserflächen, Berge - die natürliche Barrieren für die Bewegung von Menschen und Tieren darstellen konnten. Die genetischen Daten deuten darauf hin, dass diese ökologischen Vielfalt sowie kulturelle und soziale Faktoren die Mobilität und Vermischung von Bevölkerungsteilen maßgeblich einschränkten.
So blieb der genetische Austausch zwar geringer als die archäologischen Gemeinsamkeiten vermuten lassen, was bedeutet, dass Technologietransfers und kultureller Austausch durchaus stattfanden, der genetische Vermischungsanteil aber begrenzt war. Methodisch ist der Erfolg der DNA-Rekonstruktion bemerkenswert, da die klimatischen Bedingungen der Sahara DNA-Erhalt nur in sehr geringem Maße begünstigen. Die Forscher setzten spezielle DNA-Extraktions- und Anreicherungsverfahren ein, um trotz der niedrigen Ausgangsmaterialien aussagekräftige genomische Daten zu gewinnen. Dabei konnte die Kombination aus traditionellen molekularen Techniken und hochmodernen bioinformatischen Analysen detaillierte Einsichten in Verwandtschaftsbeziehungen, Herkunft und Vermischung der antiken Individuen geliefert werden. Die Ergebnisse liefern somit einen fundierten Fensterblick in die Geschichte der Besiedlung Nordafrikas, der die Bedeutung der Region als eigenständigen und genetisch besonderen Vorfahrenpool unterstreicht.
Sie erweitern unser Verständnis von der großen migrations- und kulturgeschichtlichen Dynamik des Kontinents und ergänzen die bisherigen Erkenntnisse zur Ausbreitung des Menschen aus Afrika. Darüber hinaus ermöglichen diese Studien neue Perspektiven zur Erforschung der Auswirkung klimatischer Schwankungen auf Populationen und besiedelte Räume. Die Grüne Sahara erwies sich als ein Knotenpunkt komplexer Prozesse, in denen Umwelt, Kultur und Genetik eng verflochten sind. Künftige Untersuchungen mit umfangreicher genomischer Datengrundlage könnten das Bild noch weiter verfeinern und Fragen zu weiteren Migrationen, genetischer Diversität und Anpassung der Menschen in diesem außergewöhnlichen Raum klären. Abschließend lässt sich festhalten, dass die Analyse antiker DNA aus der Grünen Sahara entscheidend dazu beiträgt, die Ursprünge der nordafrikanischen Bevölkerung besser zu verstehen.
Die entdeckte ursprünglich nordafrikanische Abstammungslinie eröffnet wichtige neue Einblicke in die frühe Besiedlungsgeschichte des Kontinents und zeigt die Sahara nicht nur als natürliche Barriere, sondern auch als ein Reservoir alter genetischer Vielfalt, die bis heute nachwirkt.
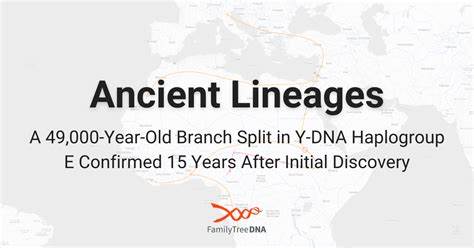





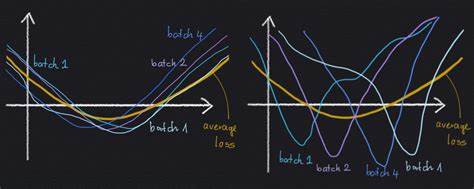
![Why Perplexity Will Fail [video]](/images/756D440E-D539-4F0F-A3CF-BB8F82185BB6)