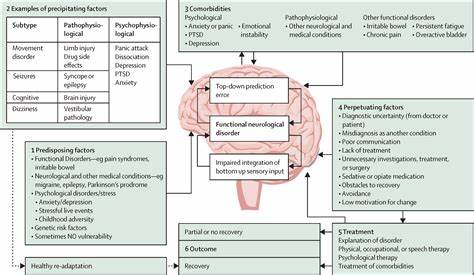Die Freiheit der physischen Bewegung ist ein grundlegendes Menschenrecht, das in internationalen Dokumenten wie der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankert ist. Dieses Recht wird meist als selbstverständlich angesehen, doch in vielen Institutionen in Indien, insbesondere an Hochschulen, wird es auf alarmierende Weise verletzt. Die Praxis einiger indischer Universitäten, Studierenden die Freiheit zu nehmen, sich frei auf dem Campus oder darüber hinaus zu bewegen, stellt eine gravierende Verletzung ihrer Menschenrechte dar. Ein anschauliches Beispiel für solche Einschränkungen bietet das Verhalten am Vellore Institute of Technology (VIT). Hier wird die Bewegungsfreiheit der Studierenden rigoros kontrolliert und reguliert.
Wenn ein Studierender beispielsweise versucht, den Campus zu verlassen, wird er von einem uniformierten Wachpersonal daran gehindert. Ohne ausdrückliche Erlaubnis der Eltern und die Weiterleitung dieser Genehmigung an das Wachpersonal durch die Fakultät ist ein Verlassen oder Wiedereintritt zum Campus nicht möglich. Nach Verlassen des Geländes werden die Eltern zudem in Echtzeit per SMS informiert. Diese Einschränkungen gelten über die Zeit eines ganzen Semesters hinweg, insbesondere für Studierende, die im Hochschulwohnheim leben. Hinter dieser strengen Überwachung steht die offizielle Begründung des Schutzes der Studierenden vor Gefahren außerhalb des Campus.
Dabei wird angenommen, dass Bring- und Abholverbot, das ständige Beobachten und das Verhindern des Verlassens den Studierenden dabei helfen soll, keine riskanten Aktivitäten wie Alkoholgenuss, Drogenkonsum, sexuelle Beziehungen oder gar den Kontakt zu problematischen Gruppierungen zu pflegen. Die Hochschule führt auch regelmäßig Zimmersuchen durch und verlangt, dass Fenster zur Einsicht offen bleiben, um jegliches „Fehlverhalten“ feststellen zu können. Diese Vorgehensweise ist eine Form permanenter Überwachung und Bevormundung. Die Situation offenbart eine grundlegende Missachtung der Autonomie junger Erwachsener. Studierende, die rechtlich als Erwachsene gelten, werden hier wie Kinder oder Gefangene behandelt.
Ihre Entscheidungsfähigkeit wird nicht respektiert, und ihre persönliche Würde wird massiv beeinträchtigt. Während Hochschulen das Recht und die Verantwortung haben, die Sicherheit ihrer Studierenden zu gewährleisten, darf dies nicht zu einer vollständigen Entmündigung der Personen führen. Das Spannungsfeld zwischen Schutz und Freiheit ist komplex, besonders wenn es um junge Menschen geht. Gesellschaftlich wird die autonome Entscheidungsfähigkeit von jungen Erwachsenen anerkannt, weshalb ihnen viele Rechte zugesprochen werden. Eine übermäßige Einschränkung ihres Handelns mit dem Argument der Schutzbedürftigkeit widerspricht der Grundidee von Freiheit und Menschenwürde.
Die Verwendung des Sicherheitsarguments als Rechtfertigung für eine Disziplinierung, die eher an Haftanstalten erinnert, verkennt diese Tatsache komplett. Darüber hinaus ist die Motivation dieser strengen Kontrollen häufig nicht allein das Wohl der Studierenden. Vielmehr spielt die Angst der Institutionen vor rechtlicher Haftung eine wesentliche Rolle. Für den Fall, dass Studierende vor oder nach dem Verlassen des Campus in unerwünschte Situationen geraten, befürchten Hochschulen Konsequenzen und Schaden für ihr Ansehen. Dieser institutionelle Selbstschutz hat direkte Auswirkungen auf die persönliche Freiheit der Studierenden, die zu einem Kollateralschaden wird.
Die Hochschulen reagieren außerdem auf den Druck vieler Eltern, die ebenfalls auf den Schutz und die ständige Überwachung ihrer Kinder pochen, oft ohne zu berücksichtigen, dass dadurch fundamentale Rechte beschnitten werden. Das Problem wird durch die Machtungleichheit zwischen Studierenden und Hochschulen noch verschärft. Zugang zu guten Hochschulen ist oft die Grundlage für beruflichen Erfolg. Um den Studienplatz zu erlangen, müssen Studierende neben hohen Prüfungsleistungen auch erhebliche finanzielle Mittel aufbringen oder sich enormen gesellschaftlichen Erwartungen stellen. Diese Abhängigkeit zwingt viele dazu, strenge und menschenrechtswidrige Regelungen hinzunehmen.
Die Praxis, Rechte durch Verträge oder interne Regeln faktisch aufzugeben, gleicht einem erzwungenen Verzicht auf Grundrechte, der in demokratisch verfassten Gesellschaften eigentlich nicht hinnehmbar sein sollte. Es ist vergleichbar mit Szenarien aus anderen Lebensbereichen, in denen Unternehmen oder Institutionen Macht auf Kosten der Nutzer oder Betroffenen ausüben. So würde niemand akzeptieren, dass der Besitz eines Fahrzeugs grundsätzlich bedeutet, auf Sicherheitsvorkehrungen wie Sicherheitsgurte verzichten zu müssen, nur weil alternative Fahrzeuge verfügbar sind. Dennoch wird Studierenden auf Hochschulen mit ihrer Bewegungsfreiheit oft etwas Ähnliches zugemutet: „Wenn es dir nicht passt, such dir eine andere Universität.“ Diese radikale Haltung ignoriert die strukturellen Probleme und sorgt dafür, dass junge Erwachsene in ihrer Freiheitsentfaltung eingeschränkt bleiben.
Die kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründe, die zu dieser Entwicklung beitragen, sind vielfältig. In vielen Teilen Indiens herrscht eine starke Betonung von Sicherheit und Kontrolle, wobei individuelle Freiheiten noch immer einen geringeren Stellenwert genießen als kollektive Werte und elterliche Autorität. Die Gesellschaft befindet sich in einem Spannungszustand, da sie sich einerseits moderner Wertvorstellungen öffnet, andererseits aber traditionelle Machtstrukturen weiter fortbestehen. Diese Ambivalenz spiegelt sich auch im Umgang mit digitalen Medien und Privatsphäre wider: Die indische Regierung forderte beispielsweise von VPN-Anbietern eine Protokollierung der Nutzeraktivitäten und bewegt sich in Richtung einer Einschränkung von Diensten wie Proton Mail, was den Datenschutz stark untergräbt. Auch auf Universitätscampus manifestieren sich diese kulturellen Prägungen.
Die autoritäre Überwachung und Kontrolle können als Spiegelbild einer Gesellschaft verstanden werden, die das Bedürfnis nach Sicherheit über die Achtung von persönlichen Freiheiten stellt. Das führt dazu, dass Menschenrechte und individuelle Wünsche junger Menschen zu kurz kommen und institutionelle Verantwortliche sich hinter vermeintlich pragmatischen Argumenten verstecken. Die psychologischen Folgen für die Studierenden sind nicht zu unterschätzen. Das ständige Gefühl, beobachtet zu werden, die Einschränkung der eigenen Bewegungsfreiheit und die fehlende Möglichkeit, selbstbestimmt Entscheidungen zu treffen, beeinträchtigen das Selbstwertgefühl und die emotionale Entwicklung. Maslows Bedürfnispyramide zeigt, dass das Bedürfnis nach Sicherheit grundlegend ist, doch erst wenn dieses gestillt ist, kann der Mensch nach Zugehörigkeit und letztlich nach Anerkennung und Selbstverwirklichung streben.
Indische Colleges scheitern vielerorts daran, die Balance zwischen diesen Bedürfnissen zu finden, was sich langfristig negativ auf die Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten der Studierenden auswirkt. Eine Veränderung erfordert Bewusstseinswandel auf mehreren Ebenen: Bildungseinrichtungen, Eltern, Studierende und Gesetzgeber müssen ein neues Verständnis von Freiheit, Verantwortung und Menschenrechten entwickeln. Hochschulen könnten Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit ihrer Studierenden zu gewährleisten, ohne ihnen dabei die fundamentalsten Rechte zu entziehen. Dazu zählen transparente Kommunikationswege, die Förderung eines respektvollen Umgangs miteinander, Alternativen zur Überwachung und eine klare Abgrenzung zwischen Schutz und Kontrolle. Eltern müssen lernen, ihren Kindern mehr Vertrauen zu schenken und deren Autonomie zu respektieren.