Peter Turchin ist ein russisch-amerikanischer Wissenschaftler, der in den letzten Jahren vor allem durch seine vermeintliche Fähigkeit, politische Instabilität und gesellschaftlichen Zerfall vorherzusagen, Aufmerksamkeit erregt hat. Mit seinem Konzept der „Cliodynamik“, einer mathematisch-quantitativen Analyse historischer und sozialer Prozesse, verspricht Turchin Einblicke in komplexe gesellschaftliche Entwicklungen, die anderen Wissenschaftlern oft verschlossen bleiben. Sein jüngstes Werk, „End Times: Elites, Counter-Elites, and the Path of Political Disintegration“, stellt seine Theorien gebündelt dar und wird von Anhängern als prophetische Warnung vor bevorstehendem politischen Chaos gefeiert. Doch bei genauerem Hinsehen erweist sich Turchins Ansatz als problematisch und seine Prognosen als nicht haltbar. Die Kernthese von Turchin basiert auf einem Phänomen, das er als „Eliteüberproduktion“ beschreibt.
Gemeint ist die Überzahl von Menschen, die ambitioniert sind, sich gesellschaftlich nach oben zu arbeiten, die aber auf eine begrenzte Anzahl von Positionen in der Elite treffen. Dieses Missverhältnis führt laut Turchin dazu, dass sogenannte „Gegen-Eliten“ entstehen, die sich mit dem Unmut der breiten Masse verbünden, um politische Unruhen auszulösen. Die Macht und der Einfluss dieser Gegen-Eliten versetzen Staaten in gefährliche Instabilitätsphasen, die schließlich zu Revolutionen, Bürgerkriegen oder gar zum Zerfall ganzer Gesellschaften führen können. Obwohl diese Idee zunächst eingängig erscheint, sorgt die mangelnde Klarheit darüber, wer eigentlich genau zur „Elite“ zählt, für große Verwirrung. Turchin definiert Elite zunächst zahlenmäßig als die reichsten zehn Prozent der Bevölkerung – eine klare und greifbare Definition.
Im weiteren Verlauf weicht er jedoch darauf aus und inkludiert jegliche Form von Machtinhabern: Regierungsmitarbeiter, Militärpersonal, Medienvertreter, Akademiker und sogar Influencer in sozialen Netzwerken. So dehnt sich der Begriff der Elite weit aus und verliert an wissenschaftlicher Schärfe und Aussagekraft. Die Kritik an Turchins Konzept der Eliteüberproduktion bezieht sich auch auf die Frage, wann und warum genau diese Überproduktion zu einer Instabilität führen soll. Seine Vorstellung gleicht einem Spiel von musikalischen Stühlen, bei dem immer mehr Spieler kommen, aber die Anzahl der Stühle unverändert bleibt. Diese Analogie greift jedoch nur bedingt, da viele Positionen, die als elitär gelten, nicht starr begrenzt sind.
Beispielsweise gibt es heutzutage zahllose Möglichkeiten, sich an politischen oder wirtschaftlichen Machtpositionen zu beteiligen, wobei neue Technologien und Medienkanäle traditionelle Zugangsbarrieren aufweichen. Besonders problematisch ist auch, dass Turchin wichtige historische Konflikte oft zu einseitig auf die Spannungen innerhalb von Eliten reduziert. So wird zum Beispiel der amerikanische Bürgerkrieg fast ausschließlich als Folge von Konflikten unter Eliteakteuren gedeutet. Dies ignoriert jedoch vollständig die zentrale Rolle breiter Bevölkerungsschichten, insbesondere der Nordstaatler, die sich ideologisch und ökonomisch gegen die Ausweitung der Sklaverei stellten. Die populären Beweggründe und die kollektive Handlungsmacht der Massen werden systematisch vernachlässigt.
Eine weitere Schwäche liegt in der unkritischen Wahl von Fallbeispielen. So zählt Turchin zum Beispiel Fidel Castro zu den „Gegen-Eliten“, die ihre marginalisierte Machtposition revolutionär in politische Umwälzungen umsetzen. Dabei war Castro keineswegs ein gescheiterter Eliteaspirant, sondern stammte aus einem wohlhabenden Umfeld und war erfolgreich in seinem Beruf als Jurist. Seine Auflehnung war vielmehr ideologisch motiviert als Ausdruck einer klassischen Eliteüberproduktion. Ähnliches gilt für die Einordnung moderner Persönlichkeiten wie Tucker Carlson als Gegen-Elite.
Carlson ist Mitglied eines reichen Clans und genoss eine erfolgreiche Medienkarriere. Er fällt nicht unter die Kategorie „frustrierter Eliteaspirant“ und beweist damit, wie wenig stichhaltig Turchins Definition der Gegen-Elite im modernen Kontext ist. Turchins Methodik konzentriert sich stark auf mathematische Modellierung und eine große Datenbank historischer Variablen – das sogenannte CrisisDB. Diese quantitative Herangehensweise hat einerseits den Vorteil der Systematisierung, führt andererseits jedoch zu einer starken Verallgemeinerung und dem Verlust des Blicks für wichtige historische, kulturelle und soziale Nuancen. Entscheidende Faktoren wie individuelle Persönlichkeiten, geografische Besonderheiten, populäre Ideologien oder unvorhersehbare Zufälle werden kaum berücksichtigt.
Seine pluralistischen Modelle tendieren dazu, düstere Vorhersagen zu treffen, was nicht zuletzt der Faszination für Katastrophenszenarien und autoritäre Steuerungsmethoden Vorschub leisten kann. Besonders problematisch wird es, wenn Turchin seine Prognosen für amerikanische Verhältnisse anwendet. Er vernachlässigt weitgehend die komplexe politische Ökonomie der Vereinigten Staaten nach 1945. Der „Great Compression“ – die Phase der Einkommensangleichung nach dem Zweiten Weltkrieg – wird zwar angesprochen, seine Analysen greifen jedoch nicht tief genug in die Ursachen und Mechanismen ein. Arbeiten von heterodoxen Ökonomen, die die Deindustrialisierung, den Aufstieg globaler Konkurrenz und die Rolle von Weltmarktkrisen erläutern, bleiben außen vor.
Dabei sind gerade diese Faktoren essenziell, um die wachsende Ungleichheit und die Erosion der Mittelschicht zu verstehen. Die sogenannte „Professionelle Managerklasse“ (PMC), eine Schicht von Wissensträgern mit teils bürokratischer und ideologischer Macht, die jedoch gleichzeitig wirtschaftlich an Boden verliert, spielt in Turchins Erzählung eine besondere Rolle. Diese Gruppe, zu der Ärzte, Anwälte und Akademiker zählen, pendelt zwischen privilegierter Elite und prekärem Mittelstand. Ihre realen Lebensbedingungen widersprechen oft romantisierten Vorstellungen von Elitenstatus. Die „Angst, zu fallen“, eine treffende Beschreibung von Barbara Ehrenreich, erfasst das Gefühl dieser Klasse gut.
Diese Abstiegsängste führen jedoch eher zu einer Stärkung autoritärer Tendenzen als zu progressiver Veränderung. Turchin versäumt es, die Rolle des modernen Staates zu analysieren – eines Staates, der über immense Ressourcen, technische Möglichkeiten und rechtliche Befugnisse verfügt. Statt um einen Zusammenbruch zu fürchten, lässt sich beobachten, dass Regierungen und Sicherheitsapparate ihre Macht durch Überwachung, Zensur und Repression ausbauen. Die Zustimmung der Bürger zu solchen Maßnahmen nimmt sogar zu, was auf eine resignative Akzeptanz von Kontrolle und Einschränkung hinweist. Turchins Modell neigt dazu, den scheinbar unvermeidlichen Zerfall und Untergang zu prophezeien, was unweigerlich zu einer Stärkung jener Elitegruppen führt, die von Angst und Ordnung profitieren.
So läuft das Bild, das er entwirft, Gefahr, soziale Kontrolle und autoritäre Staatlichkeit zu legitimieren, anstatt zu emanzipatorischen Lösungen beizutragen. Seine mangelnde Berücksichtigung der tatsächlichen Machteliten – den superreichen Milliardären, Finanzmagnaten und multinationalen Konzernen – ist ein gravierender Mangel in seiner Theorie. Stattdessen richtet er die Kritik häufig gegen eine „professionelle Mittelschicht“, die selbst zu großen Teilen unter dem neoliberalen Umbruch leidet. Die Analyse übersieht dadurch, wer in Wahrheit die politischen und wirtschaftlichen Hebel in der Hand hält. Abschließend lässt sich festhalten, dass Peter Turchins Werk viele wichtige Fragen rund um soziale Ungleichheit, politische Konflikte und gesellschaftliche Krisen adressiert, seine Erklärungen aber zu oberflächlich bleiben und mit einer unzureichenden Einordnung historischer und ökonomischer Komplexität einhergehen.
Seine mathematisch gestützten Prognosen sind nicht die allumfassenden Wahrheiten, die sie teils zu sein beanspruchen, sondern beschränken sich in ihrer Aussagekraft wesentlich auf allgemeine, bereits bekannte Prinzipien menschlicher Gesellschaften. Gerade in Zeiten wachsender politischer Spannungen und ökonomischer Unsicherheit sind differenzierte, historisch informierte und sozial komplexe Analysen unverzichtbar, um adäquate Antworten auf aktuelle Herausforderungen zu finden. In dieser Hinsicht bleibt Turchins Modell ein interessantes, aber letztlich unzureichendes Fragment einer vielschichtigen Realität.
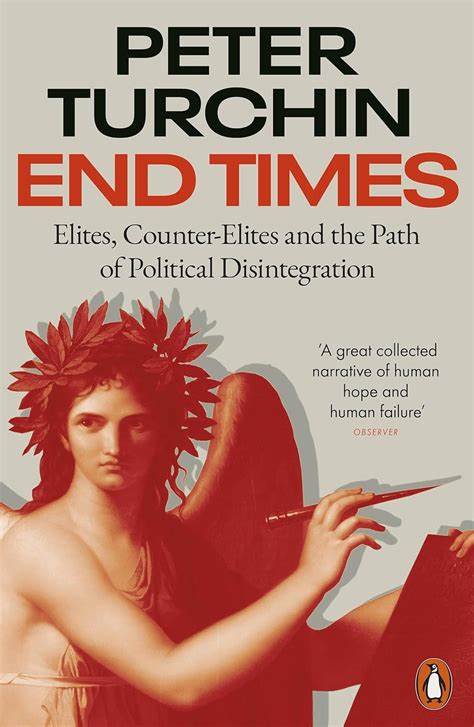


![BloombergGPT: The First Large Language Model for Finance [2023]](/images/563D0BDB-DBD0-4594-B930-966095FAF74A)

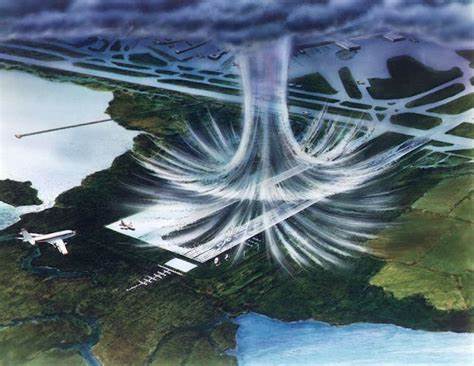


![Laid off again is tech worth it anymore? [video]](/images/A553AA14-1545-4B0F-BA79-C07D78EF8312)
