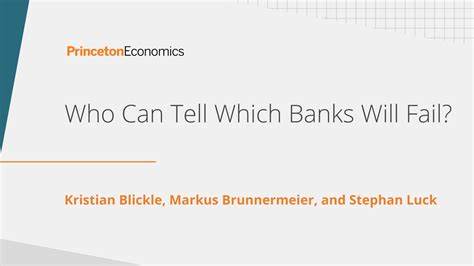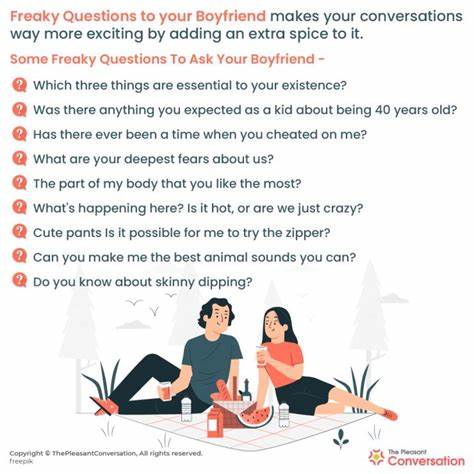Titel: Wer kann vorhersagen, welche Banken scheitern werden? Die Bankenlandschaft ist von Natur aus volatil und von zahlreichen Faktoren beeinflusst, die oft miteinander verwoben sind. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit, wie während der großen Depression in den 1930er Jahren, wird die Frage nach der Stabilität von Finanzinstituten besonders drängend. Eine neue Untersuchung, die sich mit dem deutschen Bankenzusammenbruch von 1931 auseinandersetzt, bietet interessante Einsichten darüber, wie Einleger und Investoren auf Bankenscheitern reagieren und wer tatsächlich in der Lage ist, das Versagen von Banken vorherzusagen. Die Forscher Kristian Blickle, Markus K. Brunnermeier und Stephan Luck von der National Bureau of Economic Research (NBER) haben in ihrem kürzlich veröffentlichten Arbeitsbericht herausgefunden, dass die Dynamik von Bankausfällen und Bankruns komplexer ist, als man auf den ersten Blick annehmen könnte.
Ein zentrales Ergebnis ihrer Studie ist, dass gewöhnliche Einleger, also die Menschen, die täglich ihr Geld bei Banken deponieren, oft nicht in der Lage sind, kriselnde Finanzinstitute zu identifizieren. Während eines Bankruns, einer Situation, in der viele Kunden gleichzeitig ihr Geld abziehen, erlebten die betroffenen Banken einen Rückgang der Einlagen um etwa 20 Prozent. Die Studie zeigt, dass sowohl Einzelpersonen als auch nicht-finanzielle Großkunden gleichmäßig Geld von sowohl gescheiterten als auch überlebenden Banken abziehen. Dies legt nahe, dass reguläre Einleger nicht über die Informationen verfügen, um die Solidität von Banken zu bewerten. Im Gegensatz dazu erweist sich der Interbankenmarkt als wesentlich präziser in der Identifikation von problematischen Banken.
Denn während der Interbankenmarkt für angeschlagene Banken vollständig zusammenbricht, können gesunde Banken weiterhin Kredite von anderen Banken aufnehmen, um den Abfluss ihrer Einlagen zu kompensieren. Diese Erkenntnisse werfen grundlegende Fragen über die Wirksamkeit von Einlagensicherungsystemen auf. Einlagensicherungssysteme sollen das Vertrauen der Einleger erhöhen und somit eine Massenpanik verhindern. Doch die Studie legt nahe, dass die Möglichkeit von moralischem Risiko, also der Annahme, dass Banken durch die Garantie von Einlagen fahrlässiger werden, in diesem historischen Kontext möglicherweise nicht so problematisch ist, wie angenommen. Wenn reguläre Einleger nicht in der Lage sind, die Risiken zu bewerten, lässt sich argumentieren, dass sie durch den Schutz, den Einlagensicherungsysteme bieten, nicht zu riskantem Verhalten angeregt werden.
Stattdessen könnte der Interbankenmarkt als das effektive Instrument zur „Disziplinierung“ von Banken fungieren. Banken, die in der internen Finanzierungsrunde scheitern, erfahren sofort die Folgen durch den Verlust des Zugangs zu kurzfristigen Krediten. Diese Dynamik zwingt Banken, ihre finanzielle Gesundheit ständig im Auge zu behalten und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um das Vertrauen anderer Banken zu gewinnen. Die Erkenntnisse aus der Studie sind auch in der heutigen Zeit von großer Bedeutung. In einer Ära, in der globale Finanzkrisen jederzeit ausbrechen können, ist es von größter Wichtigkeit, Mechanismen zu verstehen, die die Stabilität unseres Finanzsystems garantieren.
Der Zusammenbruch von Banken kann katastrophale Folgen nicht nur für die betroffenen Institutionen haben, sondern auch für die gesamte Wirtschaft. Die Bankenkrise von 2008 illustrierte dies eindrücklich, als die Insolvenz einer einzigen Institution wie Lehman Brothers eine weltweite Kettenreaktion auslöste. Die Frage bleibt jedoch: Wer ist nun in der Lage, die kommenden Bankausfälle vorherzusagen? In der Vergangenheit haben Analysten und Ökonomen versucht, Modelle zu entwickeln, die es ermöglichen, frühzeitig auf Insolvenzrisiken zu reagieren. Doch gerade die Unberechenbarkeit menschlichen Verhaltens und globale wirtschaftliche Trends machen genaue Vorhersagen schwierig. Ein wichtiges Element ist das Vertrauen.
Wenn Einleger das Gefühl haben, dass ihre Bank in Schwierigkeiten steckt, kann bereits eine Gerüchtewelle oder das schlechte Abschneiden einer Bank in den Medien ausreichen, um einen Bankrun auszulösen. Diese psychologischen Faktoren sind oft kaum zu quantifizieren, aber sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Wahrnehmung von Finanzinstituten. Die Erkenntnisse aus der Studie deuten zudem darauf hin, dass eine verstärkte Transparenz und Informationsverfügbarkeit über die finanziellen Zustände von Banken notwendig sind, um das Vertrauen der Einleger zu stärken und panikartige Abhebungen zu vermeiden. Wenn Konsumenten über die Stabilität ihrer Banken informiert sind, können sie fundiertere Entscheidungen treffen und Ängste verringern. Zudem könnte eine verstärkte Regulierung von Banken in Bezug auf ihre Verbindlichkeiten und Risikomanagementpraktiken dazu beitragen, das Vertrauen der Einleger zu stärken und, im Falle eines Bankruns, die quantitativen Modelle zur Vorhersehbarkeit von Bankenkrisen zu verbessern.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass während gewöhnliche Einleger oft nicht in der Lage sind, das Versagen ihrer Banken zu erkennen, der Interbankenmarkt eine bessere Einschätzung der Risiken bietet. Die Studie über die Finanzkrise von 1931 liefert uns wertvolle Lehren, wie wir mit der Unsicherheit im Finanzsektor umgehen können. In einer Welt, in der Banken eine zentrale Rolle bei der Finanzierung von Unternehmen und Haushalten spielen, ist es unerlässlich, das Vertrauen in das Finanzsystem aufrechtzuerhalten und Mechanismen zu entwickeln, die Banken in Krisenzeiten nicht nur entlasten, sondern auch die verantwortungsvolle Führung und das Risikomanagement fördern.