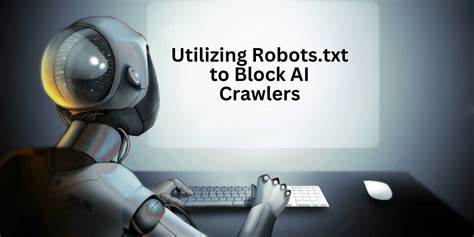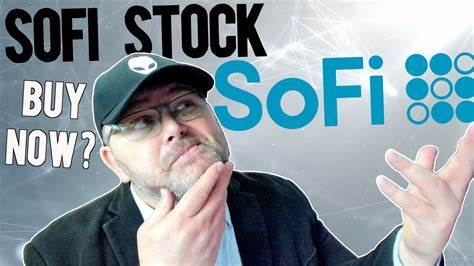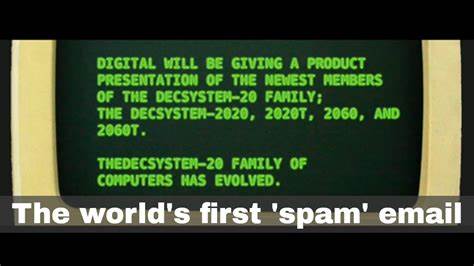Im Jahr 2025 hat Australien einen klaren politischen Kurs für seine Energiepolitik festgelegt: Kernenergie wird in absehbarer Zeit nicht Teil des nationalen Energiemixes sein. Diese Entscheidung resultiert aus dem Wahlergebnis der Bundeswahlen, in denen die Australian Labor Party unter der Führung von Premierminister Anthony Albanese bestätigt wurde. Mit dem Wahlsieg wurde ein vehementes Nein zum Vorschlag der Oppositionspartei ausgesprochen, der Kernenergie als Lösung für eine preisgünstige und zuverlässige Stromversorgung einführte. Die Debatte um Kernenergie in Australien gewann im Vorfeld der Wahl zunehmend an Aufmerksamkeit, doch letztendlich konnte sich die Vision der Australian Labor Party durchsetzen, die auf den Ausbau erneuerbarer Energien setzt. Die Ablehnung der Kernenergie gründet sich auf eine Kombination aus ökonomischen, ökologischen und politischen Faktoren, die in der breiten Öffentlichkeit und im Parlament auf große Zustimmung treffen.
Die Oppositionspartei unter Peter Dutton hatte sieben Kernkraftwerke an Standorten geplant, an denen Kohlekraftwerke stillgelegt wurden oder stillgelegt werden sollten. Diese sollten sowohl große Reaktoren als auch modulare Kleinreaktoren umfassen, die bis 2035 beziehungsweise 2037 in Betrieb genommen werden sollten. Das Versprechen lautete, durch den Aufbau der Kernkraftwerke eine stabilere und günstigere Stromversorgung zu garantieren und die Abhängigkeit von chinesischen Wind- und Solartechnologien zu reduzieren. Trotz dieser ambitionierten Planung konnten die Kostenschätzungen und die langfristige Umsetzbarkeit die Öffentlichkeit und Experten nicht überzeugen. Institutionen wie die CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) und die Australian Energy Market Operator (AEMO) bestätigten, dass Kernenergie im Vergleich zu erneuerbaren Energien deutlich teurer ausfallen würde.
Während die Oppositionspartei von Kosten von etwa 30 australischen Dollar pro Megawattstunde sprach, gehen andere Analysen von bis zu 145 bis 238 australischen Dollar pro Megawattstunde aus. Diese deutlichen Diskrepanzen führten dazu, dass das wirtschaftliche Argument für die Kernenergie zunehmend ins Wanken geriet. Auch in Bezug auf die Klimaneutralität konnte die Kernenergie nicht punkten. Der Plan sah vor, alte Kohlekraftwerke über längere Zeit weiter zu betreiben, bevor die Kernkraftwerke an deren Stelle traten. Analysen der Climate Change Authority wiesen darauf hin, dass dieser Übergang mit erheblichen zusätzlichen CO2-Emissionen verbunden wäre – im Bereich von 1,7 bis 2 Milliarden Tonnen bis zum Jahr 2050.
Im Gegensatz dazu positioniert sich die Labor Party mit einer nachhaltigen Energiepolitik, die den Anteil erneuerbarer Energien bis 2030 auf 82 Prozent steigern und damit die Klimaziele viel konsequenter erfüllen will. Die öffentliche Meinung spiegelt diese Differenzen wider. Umfragen zeigen, dass nur etwa ein Drittel der australischen Bevölkerung Kernenergie befürwortet, wobei die Zustimmung noch geringer ausfällt, wenn die Details und Herausforderungen der Kernenergiepolitik bekannt werden. Viele Bürgerinnen und Bürger fürchten vor allem hohe Kosten, Sicherheitsrisiken sowie ungelöste Fragen bezüglich der Endlagerung von radioaktivem Abfall. Auch auf politischer Ebene erfuhr die Kernenergiepolitik keine Unterstützung über die Reihen der konservativen Opposition hinaus.
Labor, die Grünen und unabhängige Abgeordnete lehnten die Aufhebung des bestehenden Bundesverbots für Kernenergie ebenso ab wie die meisten Bundesstaaten, deren Landesregierungen klare Verbote besitzen. Bundesstaatliche Premierminister, darunter der LNP-Premier von Queensland, David Crisafulli, und der liberale Oppositionsführer von Victoria, Brad Battin, äußerten sich offen gegen die Kernenergiepläne. Diese starke politische Blockade macht eine Umsetzung äußerst schwierig. Darüber hinaus erlaubten es politisches Geschick und gezielte Kampagnen der Labor Party, das Thema Kernenergie während des Wahlkampfs als riskant, teuer und unzuverlässig darzustellen. Der damalige Energieminister Chris Bowen bezeichnete die Kernenergiepolitik als „Voldemort-Politik“ – ein Synonym für etwas, über das man in Wahlkämpfen nicht sprechen möchte, da es politisch unpopulär ist.
Diese Taktik traf den Nerv der Wähler, die angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten Stabilität und bezahlbare Energielösungen suchten. Stattdessen setzte Labor auf den Ausbau von Solarenergie, Windkraft, Batteriespeichern und Pumpspeicherwerken. Der Erfolg dieses Ansatzes zeigt sich bereits: Bis 2025 stieg der Anteil erneuerbarer Energie im australischen Stromnetz um 25 Prozent, und über 330.000 Haushalte installierten Solaranlagen auf ihren Dächern. Australien hat mit seinen natürlichen Ressourcen – viel Sonne und windreiche Regionen – ideale Voraussetzungen, um den Energiemix zukunftssicher mit erneuerbaren Energien zu gestalten.
Diese Stärken sollen in den nächsten Jahren weiter ausgebaut werden. Offshore-Windparks beispielsweise sollen in einer Fläche von mehr als 30.000 Quadratkilometern im Commonwealth-Gewässern entstehen und damit eine wichtige Rolle spielen. Gleichzeitig werden Investitionen in Energiespeicher und die Modernisierung der Netzinfrastruktur notwendig, denn der Ausstieg aus der Kohle bis 2035 stellt eine große Herausforderung dar. Die politische Entscheidung gegen die Kernenergie bedeutet, dass auch mit den typischen Herausforderungen der Kernenergieanlagen – Kostenexplosionen, lange Bauzeiten, Sicherheitsrisiken und die ungelöste Problematik der radioaktiven Abfälle – keine direkten Belastungen für Australien entstehen.
Stattdessen fokussiert sich die Bundesregierung auf Innovationen und Technologien, die eine dekarbonisierte Zukunft ermöglichen. Die nächsten Jahre werden zeigen, inwieweit Australien seine ehrgeizigen Ziele erreichen kann. Dabei müssen Fragen der Versorgungssicherheit und der Preisstabilität weiterhin im Mittelpunkt stehen. Trotz aller Herausforderungen ist die Ablehnung der Kernenergie ein klares Signal dafür, dass Australien als Land entschlossen auf eine nachhaltige und umweltfreundliche Energieversorgung setzt. Während andernorts weltweit über die Renaissance der Kernenergie diskutiert wird, setzt Australien auf bewährte erneuerbare Technologien und fördert deren Ausbau mit Nachdruck.
Die Nachhaltigkeit und die soziale Akzeptanz dieser Technologien stehen dabei im Vordergrund. Abschließend lässt sich sagen, dass die Entscheidung gegen die Kernenergie und für den Ausbau von Solarkraft, Windenergie und Batteriespeichern die Weichen für einen modernen, klimafreundlichen und technologisch fortschrittlichen Energiemix in Australien stellt. Das Land positioniert sich damit als Vorreiter in der Region und hält an seinen Klimazielen fest, die mit einem nachhaltigen Energiesystem erreichbar sind. Dieses Engagement beruhigt Investoren, Verbraucher und politische Entscheidungsträger gleichermaßen und zeigt, dass die Zukunft Australiens in erneuerbaren Energien liegt – ohne Atomkraftwerke.