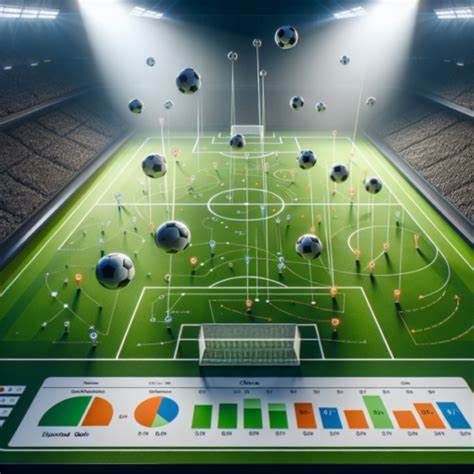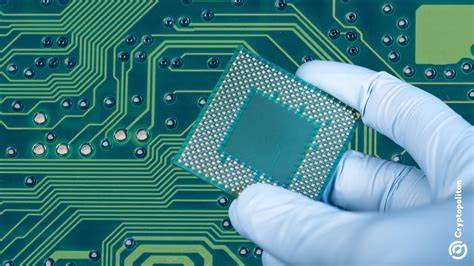In der heutigen Welt des Marketings und der Marktforschung spielt die sogenannte Intention-Action Lücke eine immer bedeutendere Rolle. Diese Lücke beschreibt die Diskrepanz zwischen dem, was Menschen in Umfragen angeben, und dem, wie sie tatsächlich handeln. Trotz vielfältiger Bemühungen, das Verhalten der Verbraucher besser zu verstehen, bleibt diese Differenz eine der größten Herausforderungen für Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Besonders im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz (KI) rückt das Thema zunehmend in den Fokus, da immer mehr Daten und innovative Technologien das Potenzial bieten, das Verhalten von Konsumenten präziser vorherzusagen und somit effektivere Strategien zu entwickeln. Doch warum gibt es diese Lücke überhaupt, und wie kann KI helfen, sie zu schließen? Diese Fragen sollen im Folgenden eingehend beantwortet werden.
Die Intention-Action Lücke ist kein neues Phänomen, sondern ein grundlegendes Problem in der Sozial- und Marketingforschung. Klassische Studien und Umfragen decken oft auf, dass Menschen sich anders ausdrücken als sie tatsächlich handeln. Der berühmte Beitrag in der Harvard Business Review unter dem Titel „The Elusive Green Consumer“ zeigt beispielhaft auf, dass 65 Prozent der Befragten angeben, bei ihren Einkäufen nachhaltige und umweltbewusste Produkte bevorzugen zu wollen. In der Realität liegt der Anteil derjenigen, die tatsächlich ihr Geld so ausgeben, aber bei nur rund 26 Prozent. Diese fast 40 Prozentpunkte große Differenz illustriert sehr deutlich, wie stark Handeln und Sprechen auseinanderklaffen.
Dieses Phänomen zeigt sich nicht nur bei Produkten mit ökologischem Hintergrund, sondern taucht in zahlreichen anderen Bereichen auf: Menschen geben an, sich gesünder ernähren oder mehr Sport treiben zu wollen, ethisch und sozial verantwortlich einkaufen zu wollen oder besser mit Geld haushalten zu wollen. Meistens bleiben diese Absichten jedoch Wunschdenken und schlagen sich nicht im tatsächlichen Verhalten nieder. Die Ursachen für die Intention-Action Lücke sind vielfältig. Einerseits spielen soziale Erwünschtheit und der Wunsch, in der Öffentlichkeit positiv wahrgenommen zu werden, eine zentrale Rolle. Antworten in Umfragen reflektieren oftmals nicht die echten Präferenzen, sondern solche, die gesellschaftlich als angemessen oder vorbildlich gelten.
Andererseits wirken sich auch psychologische, finanzielle und praktische Barrieren bei der Umsetzung von Absichten aus. Obwohl der Wunsch zum Beispiel besteht, nachhaltig einzukaufen, sind höhere Preise, eingeschränkte Verfügbarkeit oder Mangel an Informationen oft Gründe, warum die guten Vorsätze nicht realisiert werden. Die Herausforderungen, die durch diese Diskrepanz entstehen, sind für Marktteilnehmer erheblich. Wenn Marktforschung auf Basis dieser verzerrten Angaben Prognosen erstellt, schöpfen Unternehmen Gefahr, Fehlentscheidungen zu treffen oder Ressourcen ineffizient einzusetzen. Bei der Entwicklung von Produkten, der Gestaltung von Marketingkampagnen oder der Positionierung von Marken entstehen so teils gravierende Fehleinschätzungen, die langfristig den Geschäftserfolg beeinträchtigen können.
In diesem Kontext gewinnt der Einsatz Künstlicher Intelligenz an Bedeutung. Insbesondere synthetische Marktforschung mit KI-generierten Personas bietet eine neue Möglichkeit, das Verhalten von Konsumenten besser abzubilden. Standardmäßig spiegeln KI-Modelle oft die vorhandenen menschlichen Daten wider, inklusive deren Verzerrungen und sozial erwünschter Antworten. So zeigte ein Experiment anhand der Wahl zwischen zwei Autos – einem teuren, umweltfreundlichen und einem günstigeren, konventionellen Modell –, dass ein KI-Modell fast 78 Prozent der Befragten auf den grünen Wagen setzen ließ. Dies entspricht der typischen Verzerrung in traditionellen Umfragen, jedoch nicht dem realen Kaufverhalten, das von Preisempfindlichkeit geprägt ist und den Marktanteil umweltfreundlicher Fahrzeuge wesentlich geringer hält.
Dieses Ergebnis verdeutlicht, dass reine Nachbildung von Umfrageantworten keinen echten Erkenntnisgewinn bringt, wenn diese nicht mit der Realität übereinstimmen. Die Lösung liegt in einer gezielten Kalibrierung der KI-Modelle. Durch Auswahl und Anpassung der verwendeten Algorithmen lässt sich der Bias, der aus sozialen Erwünschtheitseffekten resultiert, reduzieren. So konnte in einem weiteren Schritt die Nutzung eines anderen KI-Modells, genannt Sonnet, dazu führen, dass nur noch etwa 37 Prozent der synthetischen Antworten das teurere, grüne Auto bevorzugten. Diese Zahl liegt deutlich näher an den tatsächlichen Verkäufen und stellt eine realistischere Einschätzung des Verhaltens dar.
Somit bietet der richtige Einsatz von KI und eine bewusste Modellwahl die Chance, die Intention-Action Lücke nicht nur in der Theorie zu diskutieren, sondern tatsächlich messbar zu verkleinern. Darüber hinaus ist dieser Ansatz flexibel: Je nach Zielsetzung kann man entweder eher die gestellten Absichten (wie in Umfragen) abbilden oder stärker den realen Handlungen nachgehen. Das eröffnet neue Möglichkeiten für maßgeschneiderte Analysen und besser informierte Entscheidungen. Die Bedeutung dieser Entwicklung für den Bereich der Marktforschung ist enorm. Das langfristige Ziel sollte nicht lediglich sein, menschliche Aussagen automatisiert wiederzugeben, sondern echte Verhaltensprognosen zu ermöglichen.
Die herkömmlichen Methoden bleiben dabei nicht zwangsläufig obsolet, doch die Kombination aus bewährten Techniken, intelligentem KI-Einsatz und gezieltem menschlichem Expertenwissen schafft die Grundlage für fundierte Erkenntnisse. Zudem wirft die Thematik auch wichtige ethische und methodische Fragen auf. Wie stark darf man Technologien kalibrieren, um gewünschte Ergebnisse zu erzielen? Wie transparent sollten diese Prozesse sein und wie vermeidet man neue Verzerrungen durch falsch justierte Systeme? Diese Herausforderungen gilt es fortlaufend zu adressieren, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit in der Forschung zu erhalten. Abschließend lässt sich festhalten, dass die Intention-Action Lücke eine komplexe und dynamische Herausforderung darstellt, die tief in den menschlichen Verhaltensmustern verankert ist. Sie lässt sich weder leicht noch vollständig auflösen, aber durch den gezielten Einsatz von Künstlicher Intelligenz und präziser Kalibrierung können wir ihr näherkommen und zugleich besser verstehen, warum Menschen anders handeln, als sie sagen.
Die Zukunft der Marktforschung liegt somit im intelligenten Zusammenspiel von Technologie und menschlicher Interpretation, um sowohl Absichten als auch tatsächliches Verhalten realistisch abzubilden. Unternehmen, die diesen Weg konsequent verfolgen, werden langfristig erfolgreicher darin sein, Kundenwünsche zu erkennen, Angebote zu optimieren und Marktpotenziale authentisch zu erschließen.