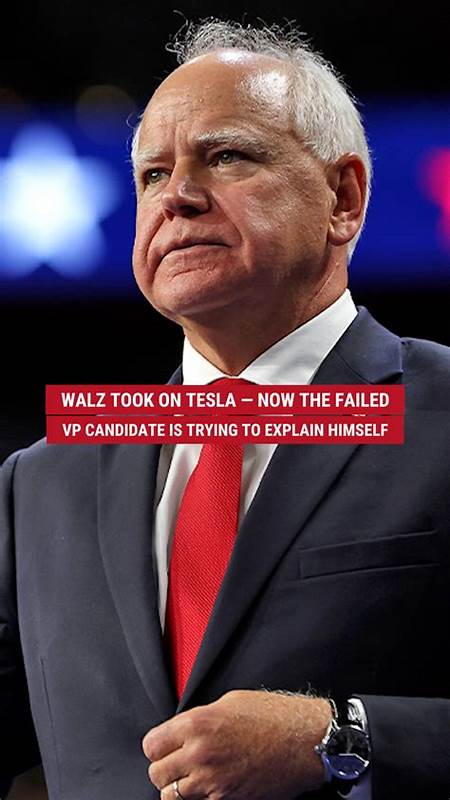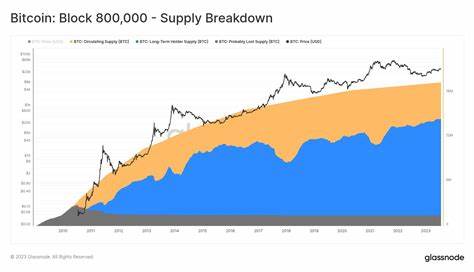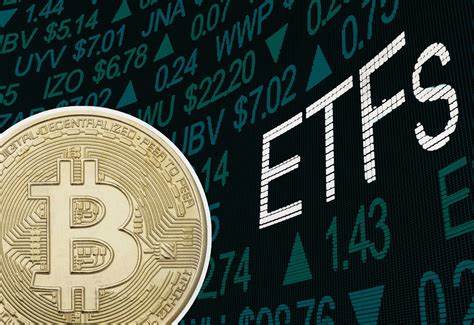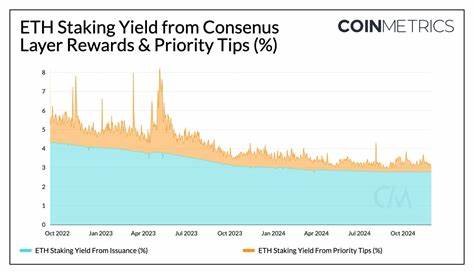Die Regulierung von Stablecoins steht im Mittelpunkt der aktuellen Diskussionen in Washington. Das sogenannte GENIUS-Gesetz, das kürzlich im Senat verabschiedet wurde, soll einen gesetzlichen Rahmen für Stablecoins schaffen. Parallel dazu verfolgt der Repräsentantenhaus mit dem STABLE-Gesetz ein ähnliches Ziel. Trotz guter Absichten stößt die vorgeschlagene Gesetzgebung auf erhebliche Kritik, insbesondere wegen der Komplexität und Ineffizienz, die durch die Einbindung zahlreicher Regulierungsbehörden entsteht. Die aktuelle Situation verdeutlicht, dass eine dringend notwendige Reform notwendig ist, um die Ziele einer stabilen, transparenten und gleichzeitig innovationsfreundlichen Regulierung zu erreichen.
Stablecoins spielen eine immer wichtigere Rolle im globalen Finanzsystem und der Digitalisierung von Zahlungsdienstleistungen. Sie tragen dazu bei, die Bedeutung des US-Dollars zu festigen und werden vermutlich in Zukunft massiv wachsen und systemrelevant werden. Dies bedeutet, dass ein Scheitern eines großen Stablecoins erhebliche Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft haben könnte. Solche Kettenreaktionen können unter Umständen zu weitreichenden wirtschaftlichen Verwerfungen führen, was das Thema der Regulierung besonders brisant macht. Aus diesem Grund müssen klare, einheitliche und effektive Regeln erlassen werden, die Risiken minimieren und Vertrauen schaffen.
Das GENIUS-Gesetz sieht derzeit vor, dass bis zu 55 verschiedene Regulierungsbehörden in die Aufsicht über Stablecoins eingebunden werden könnten. Diese Vielfalt klingt auf den ersten Blick nach umfassender Kontrolle, birgt allerdings enorme Risiken in Bezug auf bürokratische Überschneidungen, ineffiziente Arbeitsprozesse und „Regulierungs-Arbitrage“. Anbieter von Stablecoins könnten versucht sein, sich die Aufsicht zu suchen, die am wenigsten streng ist. Dieses „Rennen nach unten“ in der Regulierung gefährdet die Finanzstabilität und den Verbraucherschutz erheblich. Zudem stellt sich die Frage, warum ein System benötigt wird, in dem mehrere Stellen die gleichen Bereiche regulieren, was zu unnötigen Doppelstrukturen führt.
Hinzu kommt, dass das Gesetz vorgeschrieben hat, dass mehrere Bundesbehörden – zum Beispiel das Office of the Comptroller of the Currency (OCC), die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) und die Federal Reserve – gemeinsam an der Ausarbeitung von Regelwerken arbeiten sollen. Erfahrungen zeigen jedoch, dass gemeinsame Regulierungsverordnungen oft ein langwieriger, konfliktreicher Prozess sind, der die Umsetzung verzögern kann. Solche Verzögerungen sind gerade in einem so dynamischen Bereich wie der Blockchain- und Krypto-Welt äußerst nachteilig. Innovationen könnten ausgebremst werden, während das regulatorische Chaos weiter zunimmt. Ein weiterer kritischer Punkt besteht darin, dass das GENIUS-Gesetz keine klare Zuständigkeit für sogenannte Zins-stablecoins festlegt.
Diese Form von Stablecoins, die Zinsen erwirtschaften, fällt bisher weitgehend aus dem Regelungsrahmen heraus. Gleichzeitig sind Stablecoins, die als Wertpapiere klassifiziert werden, nicht in das Gesetz integriert und unterliegen der Aufsicht der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Dieses regulatorische Wirrwarr führt zu ständigen und komplizierten Streitigkeiten zwischen Behörden und Gerichten darüber, wer für welche Stablecoins zuständig ist.
Diese Unsicherheit wiederum schafft ein unsicheres Umfeld, das Investoren abschreckt und die Marktentwicklung belastet. Die gegenwärtige Situation macht deutlich, dass das US-Finanzsystem einer veralteten und überdimensionierten Struktur unterliegt. Über Jahre hinweg sind immer mehr Regulierungsbehörden entstanden, deren Zuständigkeiten sich überschneiden und die häufig in Konkurrenz zueinander stehen. Die berühmte Finanzkrise von 2008 zeigte bereits, wie diese Zersplitterung die Aufsicht erschwert und systemische Risiken nicht ausreichend in den Griff bekommt. Der Aufbau des Financial Stability Oversight Council (FSOC) war ein Versuch, besser zu koordinieren, doch dieser Koordinationsansatz hat sich bislang auch nicht als sonderlich effektiv erwiesen.
Vor diesem Hintergrund plädiert der renommierte Finanzexperte James J. Angel dafür, den Federal Reserve als zentrale Aufsichtsbehörde für Stablecoins zu bestimmen. Die Federal Reserve verfügt als de facto Systemrisiko-Regulierer über die notwendige Erfahrung, die institutionelle Grundlage und das Mandat, um diese wichtige Rolle zu übernehmen. Eine zentrale Instanz kann eine klare, einheitliche Regulierung gewährleisten, die sämtliche Stablecoins einschließt – unabhängig davon, ob diese Zinsen zahlen oder besondere Eigenschaften aufweisen. Eine solche Konzentration der Aufsicht würde Doppelstrukturen und interbehördliche Konflikte vermeiden helfen.
Darüber hinaus wäre es sinnvoll, auch die bestehende Regulierung in Bezug auf den SEC-Zuständigkeitsbereich zu überdenken und mögliche Schnittmengen eindeutig zu regeln. Dies würde nicht nur Klarheit schaffen, sondern auch die rechtlichen Unsicherheiten verringern, die gegenwärtig viele Akteure lähmen. Das Ziel muss ein Regulierungsrahmen sein, der Innovation fördert, Verbraucher schützt und systemische Risiken im Keim erstickt. Die derzeitige politische Landschaft bietet eine einmalige Gelegenheit, diese dringenden Reformen anzugehen. Präsident Trump hat sein Interesse bekundet, noch in diesem Jahr ein Gesetz für Stablecoins zu unterzeichnen.
Die Gesetzgeber in Senat und Repräsentantenhaus stehen also in der Verantwortung, das Gesetz so zu gestalten, dass es zukunftsfähig, effizient und konsistent ist. Es geht nicht nur darum, Regulierung zu schaffen, sondern eine Regulierung, die mit Bedacht und Weitsicht gestaltet wird. Nicht nur wird dies das Vertrauen der Nutzer stärken, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit der USA im globalen Fintech-Sektor sichern. Angesichts der rasanten Entwicklung von Blockchain-Technologien und digitalen Währungen ist eine schlanke und intelligente Regulierungsstruktur unerlässlich. Nur so kann die USA ihre führende Rolle im Bereich der Finanzinnovation behalten.
Die Diskussion zeigt auch, dass eine bloße Zunahme von Regulierungsbehörden und deren Zuständigkeiten nicht die Lösung ist. Vielmehr braucht es einen mutigen Schritt, gewachsene Strukturen zu überdenken und pragmatisch zusammenzuführen. Die Zentralisierung der Aufsicht bei der Federal Reserve könnte dabei eine wichtige Rolle spielen und Sinnbild für eine modernisierte Finanzregulierung sein, die den Anforderungen eines digitalen Zeitalters gerecht wird. Zudem müssen auch die Interessen der Verbraucher in den Fokus rücken. Sicherung der Kundengelder, Transparenz der Produkte und Schutz vor betrügerischen Angeboten sind keine Nebensächlichkeiten, sondern essenzielle Bestandteile einer funktionierenden Finanzordnung.
Der Schutz der Verbraucher und die Stabilität der Märkte dürfen nicht unter dem politischen oder bürokratischen Aufwand leiden. Abschließend lässt sich sagen, dass das so genannte GENIUS-Gesetz in seiner jetzigen Form die Chancen und Risiken der Stablecoin-Regulierung nicht optimal adressiert. Es besteht die Gefahr einer bürokratischen Überregulierung, die nicht nur die Kosten für die Branche und die Steuerzahler in die Höhe treibt, sondern auch Innovationen behindert und systemische Risiken nicht in ausreichendem Maße im Blick hat. Die Konzentration der Aufsicht bei der Federal Reserve, der Einschluss von Zins-stablecoins in den Regulierungsrahmen und klare Zuständigkeiten sind notwendige Schritte, um aus der regulatorischen Sackgasse herauszukommen. Die Reform der Stablecoin-Regulierung ist ein zentraler Baustein für die Zukunft der digitalen Finanzwelt.
Es liegt an den Gesetzgebern, diese Herausforderung mit Weitsicht und Pragmatismus anzugehen und den Weg für eine stabile und dynamische Finanzinnovation zu ebnen, von der Verbraucher, Wirtschaft und Gesellschaft gleichermaßen profitieren können.