Im digitalen Zeitalter, in dem künstliche Intelligenz zunehmend in unseren Alltag integriert wird, verändert sich auch die Art und Weise, wie wir schreiben. Große Sprachmodelle, auch bekannt als LLMs (Large Language Models), haben das Potenzial, den Schreibprozess grundlegend zu beeinflussen. Sie bieten Unterstützung beim Verfassen von Texten, beim Zusammenfassen komplexer Inhalte und bei der Neuformulierung von Gedanken. Doch trotz ihrer vielfältigen Vorteile sind Texte, die mithilfe von LLMs erstellt wurden, nicht immer fehlerfrei oder ansprechend. Es lohnt sich daher, genauer hinzuschauen und zu verstehen, wie diese Technologie das Schreiben prägt – welche typischen Fehlerquellen es gibt, welche vermeintlich „robotischen“ Stilmittel tatsächlich sinnvoll sein können und wie ein produktiver Umgang mit LLMs gelingt.
Zunächst fällt auf, dass viele von LLMs generierte Texte eine gewisse Leere oder Oberflächlichkeit aufweisen. Häufig enden Absätze mit so genannten „leeren Zusammenfassungssätzen“, die wie ein Fazit wirken sollen, aber in Wirklichkeit nichts Neues vermitteln. Sätze wie „Durch Befolgen dieser Schritte erreichen wir bessere Ergebnisse“ klingen zwar abschließend, tragen jedoch keinerlei inhaltliche Tiefe bei. Solche Phrasen wirken eher wie eine rhetorische Verhüllung als ein echter Abschluss, was den Leser enttäuscht zurücklassen kann. Aus diesem Grund ist es wichtig, Texte mit „Abschiedsgedanken“ zu versehen, die dem Leser neue Denkanstöße bieten oder das bisher Gesagte zusammenführen, ohne dabei inhaltslos zu bleiben.
Ein weiterer häufig beobachteter Fehler ist der übermäßige Einsatz von Aufzählungen und Gliederungen. LLMs neigen dazu, Listen zu bevorzugen, besonders wenn es darum geht, Informationen übersichtlich darzustellen. Doch nicht alle Inhalte eignen sich für diese Form. Wenn Ideen stark miteinander verbunden sind oder Kontext benötigen, gerät die Bullet-Point-Struktur schnell an ihre Grenzen. Ein zusammenhängender Fließtext bietet dann oft mehr Raum, um Nuancen herauszuarbeiten und die Zusammenhänge klar zu vermitteln.
Zudem kann eine zu starke Listenorientierung den Eindruck entstehen lassen, dass der Text eher punktuell und fragmentarisch statt flüssig und in sich geschlossen ist. Auch die rhythmische Gestaltung der Sätze wirkt häufig flach und einförmig. Wenn Textsätze alle eine ähnliche Länge haben und syntaktisch kaum Variationen bieten, fehlt es dem Schriftstück an Dynamik. Rhythmus ist jedoch eine wichtige Komponente, um die Aufmerksamkeit des Lesers zu bündeln und ihn durch den Text zu führen. Abwechslung in Satzlänge und -struktur sorgt für Klarheit, erleichtert das Verständnis und macht das Lesen angenehmer.
So signalisiert ein kurzer Satz oft besondere Betonung, während längere Sätze komplexere Zusammenhänge vermitteln können. Ebenso spielt die Wahl des Satzsubjekts eine große Rolle für die Verständlichkeit. In vielen LLM-generierten Texten werden Subjekte verwendet, die nicht zum Kern der Aussage passen. Ein passendes Subjekt hält den Fokus auf dem Wesentlichen und vermeidet Ablenkungen. Wird etwa in einem Satz über Satzstruktur von „Lesern“ gesprochen, obwohl es eigentlich um grammatische Funktionen geht, entsteht Verwirrung.
Es ist daher ratsam, dass Subjekte genau das thematisieren, worauf sich die Aussage bezieht, um das Textverständnis zu optimieren. Informationendichte ist eine weitere Schwachstelle. LLM-Texte klingen häufig zwar schön formuliert, liefern jedoch wenig konkret Neues oder präzise Einblicke. Allgemeine Phrasen und unklare Aussagen ohne genauere Erläuterung hinterlassen einen vagen Eindruck. Beispielsweise werden „Expertenmeinungen“ erwähnt, ohne die Quelle oder deren Bedeutung zu benennen, oder es fehlt die genaue Erklärung, warum ein bestimmter Faktor eine Rolle spielt.
Solche fehlenden Details schwächen die Glaubwürdigkeit und den Nutzen des Textes erheblich. Vage Formulierungen sind auch deswegen problematisch, weil sie dem Leser Orientierung rauben. LLMs tendieren dazu, Begriffe zu verwenden, die nicht klar definiert sind, und treffen oft unbestimmte Aussagen. Das führt dazu, dass der Text sich in Allgemeinplätzen verliert und der Leser keine konkreten Informationen erhält. Ohne klare Definitionen, Beispiele oder Nachweise wirkt die Argumentation schwach und wenig überzeugend.
Ein weiterer Stolperstein ist die übermäßige Verwendung von demonstrativen Fürwörtern wie „dies“, „das“, „jene“. Diese Referenzen funktionieren nur dann gut, wenn unmittelbar klar ist, auf welches spezifische Substantiv sie sich beziehen. Ist dies nicht der Fall, entsteht Verwirrung und die inhaltliche Klarheit leidet. Autoren, die mit LLMs arbeiten, sollten deshalb darauf achten, stets eindeutige Bezüge herzustellen, um den Lesefluss nicht unnötig zu stören. Neben inhaltlichen Stolperfallen fällt auf, dass LLM-generierter Text oft eine „Sprachfertigkeit ohne tiefes Verständnis“ aufweist.
Das bedeutet, dass viele Sätze zwar grammatisch korrekt und stilistisch flüssig sind, inhaltlich jedoch kaum weiterhelfen oder grundlegende Zusammenhänge nicht vermitteln. So werden etwa technische Begriffe verwendet, ohne deren Bedeutung ausreichend zu erklären. Außerdem neigen LLMs dazu, Begriffe zu erfinden oder falsch zu verwenden, was zu falschen oder unbelegten Aussagen führen kann. Das macht es unerlässlich, dass menschliche Autoren Texte sorgfältig prüfen und mit eigenem Fachwissen ergänzen. Während viele Merkmale von LLM-Texten als negativ empfunden werden, gibt es auch Stilelemente, die oft fälschlicherweise als „typisch für KI“ abgelehnt werden, jedoch bei gezieltem Einsatz hilfreich sind.
Dazu gehört beispielsweise die bewusste Wiederholung als rhetorisches Mittel, um komplexe Sachverhalte zu verdeutlichen oder wichtige Punkte zu betonen. Ebenso sind signalisierende Phrasen wie „im Wesentlichen“ oder „kurz gesagt“ nützliche Wegweiser, die dem Leser helfen, anspruchsvollen Inhalt besser zu verarbeiten. Auch parallel strukturierte Sätze sind kein Zeichen von schlechter oder maschineller Schreibe. Ganz im Gegenteil erleichtern sie das Verständnis verwandter Konzepte und schaffen einen angenehmen Lesefluss. Klare und konsistente Überschriften, die in ihrer Form aufeinander abgestimmt sind, geben dem Text eine nachvollziehbare Ordnung, und damit Struktur, was das Lesen erleichtert.
Ein klarer, behauptender Satz zu Beginn eines Abschnitts mag zwar etwas mechanisch wirken, gibt dem Text aber eine starke Orientierung, wenn er durch unterstützende Argumente oder Beispiele untermauert wird. Ein weiteres ästhetisches Stilmittel, das durchaus einen Platz in gutem Schreiben hat, sind Gedankenstriche (Em dashes). Sie lockern den Satzbau auf, erzeugen rhythmische Akzente und ermöglichen prägnante Einschübe ohne Brüche im Satzfluss. Für den produktiven Umgang mit LLMs beim Schreiben empfiehlt es sich, den Prozess als eine Schleife von Planen, Schreiben, Kritisieren und Überarbeiten zu begreifen. Wichtig ist, zunächst eine klare Gliederung zu entwickeln, entweder schriftlich oder im Kopf.
Das Modell kann hierbei durch die Erstellung von strukturierten Entwürfen unterstützend wirken, doch der eigentliche Text sollte idealerweise vom Menschen verfasst werden – zumindest die erste Fassung. Auch wenn manche Sätze noch nicht glänzend sind, kann bereits ein roher Entwurf helfen, Ideen greifbar zu machen. Beim Überarbeiten ist es ratsam, gezielte Änderungswünsche an das Modell zu formulieren, statt pauschal um „Verbesserungen“ zu bitten. Beispielsweise kann man darum bitten, die Subjekt-Verb-Stellung zu optimieren oder eine kurze Geschichtenerzählstruktur anzuwenden, die auf „Jemand wollte, aber, so, dann“ basiert. Diese Methode erleichtert es, komplexe Sachverhalte nachvollziehbar darzustellen und den logischen Aufbau zu stärken.
Trotz aller technischen Hilfsmittel bleibt das eigentliche Schreiben eine kreative und bewusste Tätigkeit. LLMs können Hilfestellung leisten, Tempo machen und Schreibblockaden abbauen, doch das Urteil darüber, was zu sagen ist, wie die Gedanken organisiert werden und wann in die Tiefe gegangen wird, liegt weiterhin beim Menschen. Qualitativ hochwertige Texte zeichnen sich dadurch aus, dass sie dem Leser wirklich einen Mehrwert bieten. Die Zeit, die jemand mit Lesen verbringt, sollte sich lohnen – dies ist, neben Klarheit und Präzision, nach wie vor der zentrale Anspruch an gutes Schreiben im Zeitalter der großen Sprachmodelle.




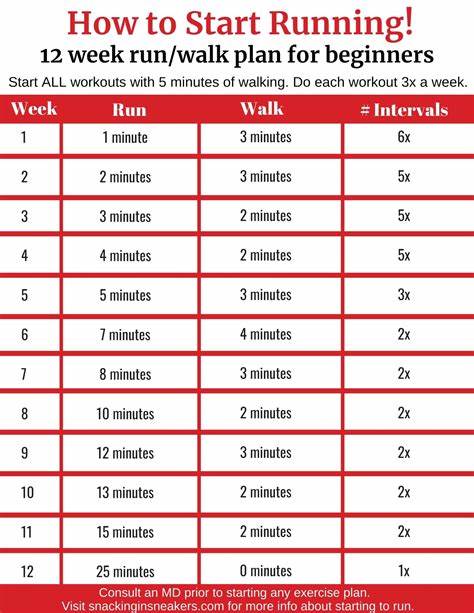
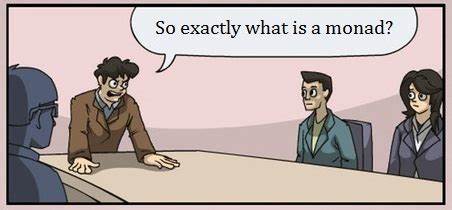
![John Carmack – Keen AI [video]](/images/835CC8BF-F50F-442B-A8FB-32EF7CC3BA2D)


