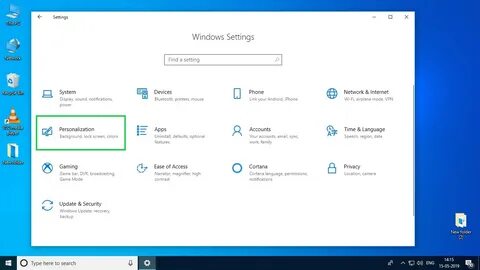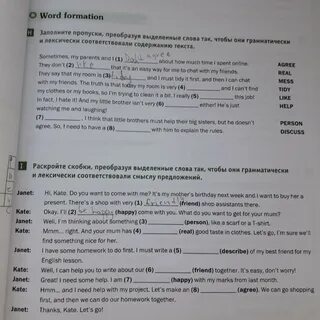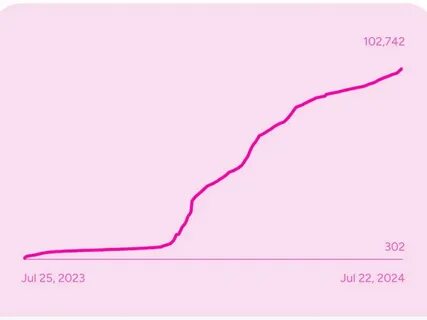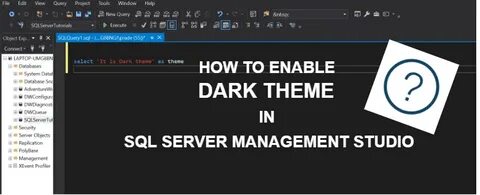Das HZ-Programm, benannt nach seinem Schöpfer Hermann Zapf, gilt als ein bahnbrechender Fortschritt im Bereich der typografischen Satztechnik. Entwickelt wurde es mit dem Ziel, die Lesbarkeit und die optische Ausgewogenheit von Texten zu verbessern, indem es die typischen Probleme beim Schriftsatz wie auffällige Wortzwischenräume – sogenannte »Rivers« – vermeidet. Diese feinen, aber störenden Flächen in einem Textbild entstehen durch zu große, unregelmäßige Wortabstände und beeinträchtigen das harmonische Gesamtbild eines Satzes. Zapfs Erfindung sollte genau hier ansetzen und für eine „perfekte graue“ Textfläche sorgen, die für den Betrachter angenehm und gleichmäßig erscheint. Die Bedeutung des HZ-Programms reicht weit über seine technische Umsetzung hinaus, denn es stellte einen Meilenstein in der Verbindung von Computertypografie und klassischem Schriftsatz dar und beeinflusste die moderne digitale Typografie nachhaltig.
Hermann Zapf, einer der renommiertesten deutschsprachigen Typografen und Gestalter von Schriften, entwickelte das HZ-Programm über mehrere Jahrzehnte. Bereits in den 1970er Jahren begann er, an computergestützten Algorithmen zu arbeiten, die es ermöglichen sollten, Texte nicht nur punktgenau zu setzen, sondern ihnen auch die notwendige typografische Finesse zu verleihen. Inspiriert von den Möglichkeiten, die der Aufkommen des Macintosh-Computers in den 1980er Jahren eröffnete, nutzte Zapf die neu verfügbare Rechenleistung und Speicherplatz, um sein Konzept in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut an der Rochester Institute of Technology und der Firma URW in Hamburg zu verfeinern und schließlich Anfang der 1990er Jahre zu einem marktreifen Spitzenprodukt zu entwickeln. Die Kerninnovation des HZ-Programms liegt in seiner Fähigkeit, die Breite einzelner Buchstaben minimal zu verändern, im Fachjargon auch als „Scaling“ oder Glyphenskalierung bezeichnet. Dabei wird die Ausgangsform eines Zeichens leicht gestaucht oder gedehnt, ohne dass dies dem Leser negativ auffällt.
Diese subtile Anpassung wird mit einem dynamischen Kerning-Algorithmus kombiniert, der nicht nur klassische negative Abstände zwischen Zeichen reduziert, sondern auch in bestimmten Fällen positive Zwischenräume ermöglicht. Diese ausgeklügelte Vorgehensweise lässt sich am besten mit dem Bild eines flexiblen Gefüges vergleichen, bei dem alle Teile so arrangiert sind, dass sie ein besonders homogenes Gesamtbild ergeben. Durch diese Methode gelingt es, den Zeilenumbruch so zu gestalten, dass unerwünschte Lücken minimiert werden und die typografische Fläche optisch einheitlicher und angenehmer wirkt. Bis heute sind die genauen Details des zugrunde liegenden Algorithmus kaum dokumentiert und stellen eine Art gut gehütetes Geheimnis dar. Zapf selbst äußerte sich in einer seiner Schriften, dass das Programm bis zu hunderte von Kerning-Paaren pro Sekunde berechnet und Entscheidungen hinsichtlich der Laufweite sowie des Zeichenabstands in Echtzeit trifft.
Dieses Niveau von Präzision und Geschwindigkeit ermöglichte es, Satzbilder zu erzeugen, die zuvor mit traditionellen Methoden kaum erreichbar waren. Das HZ-Programm wurde von URW patentiert, wobei das Patent im Jahr 2010 auslief und damit der grundlegende technische Fortschritt frei zugänglich wurde. Von großer Bedeutung ist, dass dieses Prinzip der Mikrotypografie Teile seiner Integration in bekannte Desktop-Publishing-Tools fand. Adobe Systems erwarb das Programm, um seine Technologien in Adobe InDesign zu integrieren, einem der meistgenutzten Setzprogramme weltweit. Ob der Original-Algorithmus im neuesten InDesign noch direkt verwendet wird, ist nicht öffentlich bekannt, doch die Konzepte des HZ-Programms sind heute fester Bestandteil digitaler Microtypografie.
Parallel zu Adobe fand auch das TeX-Setzsystem Eingang für Elemente des HZ-Programms. Der vietnamesisch-amerikanische Informatiker Hàn Thế Thành analysierte die Eigenschaften des Programms eingehend und transformierte sie in Erweiterungen für pdfTeX, einer erweiterten Version des TeX-Systems. Diese Erweiterungen ermöglichen Mikrotypografie – also die feine Anpassung von Laufweiten und Zeichenabständen – in Open-Source-Typografieumgebungen und werden insbesondere von wissenschaftlichen Autoren genutzt, die auf exakte typografische Kontrolle angewiesen sind. So haben Konzepte des HZ-Programms dazu beigetragen, dass auch außerhalb kommerzieller Anwendungen eine höhere Textqualität möglich ist. Trotz dieser technischen Erfolge ist das HZ-Programm nicht frei von Kritik und Mythenbildung.
Die Geheimhaltung der genauen Funktionsweise ließ Raum für Spekulationen, und manche Stimmen bezweifelten die tatsächliche Überlegenheit des Algorithmus gegenüber anderen typografischen Verfahren. Besonders die Glyphenskalierung als Mittel der Laufweitenoptimierung wurde von einigen renommierten Designern wie Ari Rafaeli kritisch bewertet. Sie argumentieren, dass die Veränderung der Formen von Buchstaben – wenn auch minimal – das klassische Schriftbild verfälschen kann und im Extremfall von der von Schriftgestaltern ursprünglich vorgesehenen Ästhetik abweicht. Zudem ist auch die in manchen Darstellungen herangezogene Verbindung zwischen dem HZ-Programm und Johannes Gutenberg, dem Erfinder des Buchdrucks mit beweglichen Lettern, kritisch zu sehen. Hermann Zapf selber verglich in Interviews und Schriften sein Programm mit der bahnbrechenden Bedeutung Gutenbergs, was in der Fachwelt unterschiedlich aufgenommen wurde.
Einige Typografen wie Torbjørn Eng bezeichneten solche Parallelen als überzogen und warnten davor, historische Errungenschaften mit modernen technischen Verfahren unreflektiert zu vermischen. Ungeachtet dieser Kontroversen bietet das HZ-Programm ein Beispiel für gelungene Synthese von traditioneller Typografiekenntnis und moderner Unternehmenssoftwareentwicklung. Die Möglichkeit, durch automatisierte, aber feine Optimierung von Zeichenabständen und Formen eine höhere Lesbarkeit und Ästhetik zu erreichen, hat Einfluss auf viele Anwendungsbereiche genommen: vom hochwertigen Buchsatz, über Zeitungsdruck bis hin zur Darstellung von Text auf digitalen Displays. Die Mikrotypografie als Disziplin gewinnt zunehmend an Bedeutung, nicht zuletzt durch die immer größere Fülle digital verfügbarer Schriften und die wachsenden Ansprüche von Designern und Lesern an bessere digitale Lesbarkeit. Das HZ-Programm hat mit seinen Konzepten und technischen Lösungen einen bedeutenden Beitrag dazu geleistet, dass Schriftsatz nicht mehr nur als schnelles Aneinanderreihen von Buchstaben verstanden wird, sondern als Kunst und präzises Handwerk, das einen erheblichen Einfluss auf das Leseerlebnis und die Wahrnehmung von Text hat.