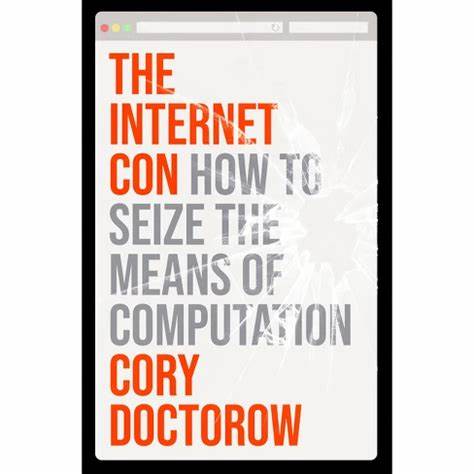Die Weltmeere sind von elementarer Bedeutung für das weltweite Klima, die Biodiversität und das menschliche Leben. Besonders die Hohe See, die internationale Gewässer jenseits nationaler Hoheitsgebiete, spielt hierbei eine zentrale Rolle. Sie umfasst etwa 61 Prozent der Ozeanfläche und ungefähr 43 Prozent der Erdoberfläche, womit sie eine gewaltige Fläche des globalen Biosphärenvolumens einnimmt. Trotz ihres enormen ökologischen Werts sind weniger als ein Prozent dieser Meeresregion weltweit geschützt. Diese Tatsache verdeutlicht, wie dringend Maßnahmen zur Bewahrung dieses einzigartigen Ökosystems sind.
Angesichts der zunehmenden Bedrohung durch Fischerei, Tiefseebergbau sowie zunehmenden Klimawandel ist ein dauerhaftes Verbot aller Formen der extraktiven Nutzung auf der Hohen See der sinnvolle und notwendige Schritt, um diesen wertvollen Lebensraum zu erhalten. Die Hohe See beherbergt eine beeindruckende Vielfalt an marinen Lebewesen. Wale, verschiedene Haiarten, Großfische wie Thunfisch sowie andere Meerestiere bestimmen das empfindliche Gleichgewicht innerhalb dieses Lebensraums. Häufig unternehmen diese Tiere weite Wanderungen, die für das Funktionieren zahlreicher ökologischer Prozesse essenziell sind. Gleichzeitig übernimmt die Hohe See eine bedeutsame Rolle als der größte Kohlenstoffspeicher der Erde.
Durch die biologische Pumpe und den Nährstoffkreislauf tragen Bewohner der Tiefsee, besonders in der Mesopelagialzone, entscheidend dazu bei, Kohlenstoff langfristig zu binden und so den Treibhauseffekt abzuschwächen. Studien belegen, dass ohne diese natürlichen Prozesse der CO2-Gehalt der Atmosphäre um etwa 200 ppm höher läge, was einer Erwärmung von circa drei Grad Celsius seit der vorindustriellen Zeit entsprechen würde. Leider hat die jahrhundertelange Nutzung der Hohen See bereits gravierende Folgen gezeigt. Angefangen mit der Walfang-Industrie des 17. Jahrhunderts, die zu einem dramatischen Rückgang der Cetaceen geführt hat, bis hin zu exzessiver Fischerei im 20.
Jahrhundert mit Auswirkungen auf Haie, Tintenfische und andere Arten, ist das Gleichgewicht dieses Ökosystems erheblich gestört. Die Nutzung der Meeresressourcen wurde zusätzlich durch staatliche Subventionen angeheizt, was den Überfischungsdruck massiv verstärkte. Gegenwärtig stammen weniger als sechs Prozent des weltweiten Fischfangs aus der Hohen See, wobei der größte Teil der gefangenen Fische vor allem an die wohlhabenden Länder geliefert wird. Dies bedeutet, dass kein globaler Nahrungsmittelnotstand durch einen Fangverzicht auf der Hohen See zu erwarten ist. Stattdessen führen Exzesse im Fischfang zu zerstörerischen Nebeneffekten wie dem massenhaften Beifang von bedrohten Tierarten, darunter Meeresschildkröten, Albatrosse und viele Haie.
Die Methoden der Tiefseefischerei sind oft verheerend für die Meeresökosysteme. Die Nutzung von Fischaggregationsgeräten, sogenannte dFADs, führt dazu, dass nicht nur die Zielarten gefangen, sondern auch wahllos andere Tiere wie Delfine und Mantarochen getötet werden. Zudem sind diese Geräte häufig verloren oder werden einfach im Meer zurückgelassen, was zu weiteren Umweltbelastungen und einer Flut aus Plastikmüll beiträgt. Des Weiteren spielt neben der Überfischung die klimabedingte Abnahme des Sauerstoffgehalts in den Ozeanen eine immer größere Rolle und verschärft die Situation der Meeresbewohner, indem sie deren Lebensräume zunehmend einschränkt. Neben der Fischerei drohen der Hohen See weitere Gefahren durch den geplanten Tiefseebergbau.
Obwohl kommerzielle Abbauarbeiten bislang nicht begonnen haben, existieren zahlreiche Explorationserlaubnisse und politische Bestrebungen, den Abbau von Polymetallknollen, Manganknollen und anderen Ressourcen zu erlauben. Befürworter argumentieren, dass diese Rohstoffe essenziell für grüne Technologien seien, doch dies ist zweifelhaft angesichts der steigenden Möglichkeiten, kritische Metalle aus Recycling und alternativen Quellen zu gewinnen. Zudem sind die Umweltauswirkungen des Tiefseebergbaus bislang kaum abschätzbar, aber wissenschaftliche Studien warnen eindringlich vor unkontrollierbaren, irreversiblen Schäden wie der Zerstörung von Lebensräumen, der Freisetzung von altem organischem Kohlenstoff, die zu langfristigen negativen Konsequenzen für das Klima führen kann. Ein weiteres Problem stellt die fehlende oder unzureichende internationale Regulierung dar. Die Internationale Meeresbodenbehörde (ISA) ist in einer problematischen Doppelfunktion als Förderer und Regulierer des Tiefseebergbaus tätig, was Interessenkonflikte verschärft und das Vertrauen in deren Entscheidungen mindert.
Auch wenn mittlerweile mehr als 30 Länder gegen eine Öffnung der Hochseebeckens für irgend eine Form der Extration stimmen, herrschen Unsicherheit, fehlende Transparenz und starke Lobbyeinflüsse, die eine verantwortungsbewusste und nachhaltige Handhabung erschweren. Die Lösung, um die Hohe See effektiv zu schützen, liegt in einem umfassenden Schutzstatus, der jegliche Form von extraktiver Nutzung wie Fischerei, Tiefseebergbau und Öl- und Gasförderung ausschließt. Dieser Schutz würde nicht das freie Schiffahrtsrecht, Erholungsnutzung oder wissenschaftliche Forschung beeinträchtigen, sondern einzig vor Raubbau schützen und dadurch langfristig das Ökosystem stabilisieren. Ein solcher Schritt wäre vergleichbar mit dem internationalen Übereinkommen, das seit 1959 die Antarktis als Friedens- und Schutzgebiet sichert und präventiv vor Ausbeutung schützt. Doch diese Idee stößt auf Hindernisse: Trotz des 2023 verabschiedeten Übereinkommens zum Schutz der Hochsee (High Seas Treaty) sind wichtige Mechanismen wie die Ratifizierung durch eine Zweidrittelmehrheit der Staaten sowie die Einhaltung von Vorschriften noch nicht vollständig umgesetzt.
Die internationale Zusammenarbeit leidet häufig an Interessengegensätzen und administrativen Herausforderungen, die eine rasche Umsetzung erschweren. Dennoch besteht ein dringender Zeitdruck angesichts der fortschreitenden Klimakrise und Biodiversitätsverluste, die nachhaltige Entwicklung auch in Jahrzehnten unmöglich machen könnten. Überdies wäre ein Rückzug aus der Nutzung der Hohen See keine wirtschaftliche Katastrophe. Die meisten hochseefischereilichen Aktivitäten sind nur durch massive Subventionen profitabel und teilweise mit menschenrechtlichen Verstößen wie Zwangsarbeit verbunden. Ein Ende solcher Aktivitäten könnte staatliche Kosten senken und gleichzeitig Druck von Artenvielfalt und MeeresÖkosystem nehmen.
Insbesondere ärmere Länder, die meist keinen eigenen Zugang zu Hochseefischerei haben, würden von einem gerechten Zugang zu gesunden Fischbeständen in ihren Küstengewässern profitieren. Die ökologische Bedeutung der Hohen See für das globale Klima und die Bewahrung mariner Biodiversität ist mit wenigen anderen Lebensräumen vergleichbar. Die biologische Pumpe und Nährstoffkreisläufe helfen, Kohlenstoff effektiv zu binden, während die intakte Fauna Nährstoffkreisläufe stabilisiert und die Produktivität der Ozeane sichert. Ein welterschütternder Kollaps dieses Systems hätte tiefgreifende Folgen für das gesamte terrestrische Ökosystem, die Luftqualität und menschliche Gesellschaften. Angesichts der vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse, ökonomischen Analysen und ethischen Erwägungen ist der dauerhafte Schutz der Hohen See vor jeglicher Ressourcenausbeutung eine der dringlichsten Aufgaben unserer Zeit.
Die hohe See darf nicht als letzte Frontier des Raubbaus gesehen werden, sondern muss als globales Gemeingut anerkannt, geschützt und bewahrt werden. Nur so kann die Vielfalt des Lebens im Meer, das Klima der Erde und das Überleben künftiger Generationen gewährleistet werden. Die Zeit zum Handeln ist jetzt. Jedes weitere Zögern könnte irreversible Schäden verursachen, die über Jahrhunderte oder gar Jahrtausende nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Die internationale Gemeinschaft, bestehend aus Staaten, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, ist gefordert, mutige Entscheidungen zu treffen und die Hohe See als einen geschützten Bereich zu etablieren.
Diese Initiative ist ein zentraler Baustein für einen nachhaltigen Planeten, der die Natur respektiert, schützt und für künftige Generationen bewahrt.