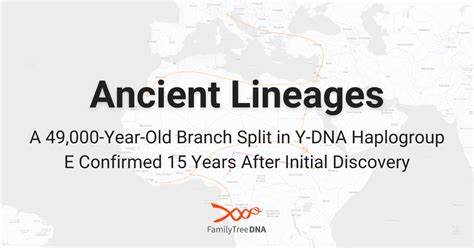Die Sahara, heute die größte warme Wüste der Welt, war nicht immer eine karge, lebensfeindliche Landschaft. Während des sogenannten Afrikanischen Feuchtzeit-Höhepunkts, vor etwa 14.500 bis 5.000 Jahren, präsentierte sich die Sahara als grünes Savannengebiet mit vielfältigen Wasserquellen, die eine reiche Tier- und Pflanzenwelt sowie frühe menschliche Gemeinschaften unterstützten. Neue genetische Studien auf Basis antiker DNA-Proben, gewonnen aus dem Takarkori-Felsunterstand in der zentralen Sahara, geben erstmals tiefgehende Einblicke in die genetische Geschichte dieser langlebigen Populationen und deren kulturelle Dynamiken.
Dabei offenbaren diese genetischen Daten eine zuvor unbekannte nordafrikanische Abstammungslinie, die sich deutlich von süd-saharischen und anderen afrikanischen Linien absetzt und im Einklang mit der archäologischen Befundlage eine kulturelle Diffusion von Hirtenwissen zeigt, ohne dass große Bevölkerungsbewegungen stattfanden. Im Zentrum dieser Forschung stehen zwei etwa 7.000 Jahre alte weibliche Individuen, die in der Takarkori-Felsunterstandsstätte im Südwesten Libyens geborgen wurden. Diese Fundstelle gilt als eines der wichtigsten Archive für die Erforschung der Grünen Sahara und liefert eine Vielzahl von Funden zur prähistorischen Besiedlung, Kulturentwicklung und Umweltveränderungen in der Region. Die hier untersuchten Individuen stammen aus der mittleren Phase der Pastoral-Neolithik und boten durch außergewöhnliche Mumifizierung gute genetische Ausgangsdaten für eine Genomsequenzierung, die trotz der herausfordernden Erhaltungsbedingungen gelang.
Die genomischen Analysen bestätigen, dass die beiden Frauen großen Anteilen einer bisher unbekannten genetischen Linie entstammen, die sich frühzeitig von süd-saharischen Linien abspaltete und bis zur Zeit der Probenahme relativ isoliert Bestand hatte. Noch faszinierender ist die enge genetische Verwandtschaft zu Populationen, die vor circa 15.000 Jahren in der Taforalt-Höhle in Marokko lebten, einem zentralen Fundort für die Iberomaurusische Kultur. Diese Verwandtschaft deutet auf eine langfristige Präsenz dieser Linie in Nordafrika hin, die vermutlich über viele Jahrtausende hinweg relativ stabil und wenig durch Migrationsbewegungen beeinflusst wurde. Zusätzlich ist bemerkenswert, dass wenig genetische Einflüsse von süd-saharischen Populationen während des Afrikanischen Feuchtzeit-Höhepunkts nachgewiesen werden konnten.
Dies steht im Gegensatz zu früheren Annahmen, die einen bedeutenden Austausch entlang dieser Nord-Süd-Achse angenommen hatten. Stattdessen legen die Daten nahe, dass die Sahara trotz der Feuchtperioden weiterhin eine natürliche Barriere darstellte, die aus geografischen, ökologischen und sozialen Gründen den genetischen Austausch begrenzte. Ein weiterer spannender Erkenntnisaspekt betrifft die Einführung der Viehzucht und die Verbreitung des Pastoralismus in der Grünen Sahara. Archäologische Befunde hatten bereits darauf hingedeutet, dass Viehhaltung und damit verbundene kulturelle Praktiken – wie etwa der Umgang mit Rindern, Schafen und Ziegen – in die Region einflossen, ohne dass eine großflächige Migration von Menschen aus dem Nahen Osten oder anderen Regionen stattfand. Die Genomdaten aus Takarkori bestätigen diesen Ansatz, da nur geringfügige Levantinische genetische Komponenten in den Profilen der untersuchten Individuen zu erkennen sind.
Dies unterstützt die These, dass die landwirtschaftlichen und herdingbezogenen Techniken vor allem durch kulturelle Diffusion verbreitet wurden – also durch die Übernahme von Ideen, Techniken und Praktiken durch indigene Populationen – und nicht durch umfangreiche Bevölkerungsbewegungen. Die genetischen Spuren von Neandertaler-Admixtur sind bei den Takarkori-Frauen ebenfalls von Interesse. Während viele Nicht-Afrikaner und einige Populationen mit nahöstlichen Wurzeln sich durch einen höheren Anteil an Neandertaler-DNA auszeichnen, weisen die Takarkori-Individuen eine nur sehr geringe Menge auf, die jedoch höher ist als in heutigen sub-saharischen Genomen. Diese Beobachtung stützt die Modellierung der Population als Mischung eines hoch divergenten nordafrikanischen Erbes mit einem kleinen Anteil levantinischer Herkunft. Es bestätigt zudem, dass die genetische Isolation der nordafrikanischen Linie lange anhielt und erst spät geringfügiges Gene-Crossover mit Außengruppen stattfand.
Die archäogenetischen Befunde unterstreichen damit die Komplexität der Besiedlungs- und Kulturentwicklung Nordafrikas während des späten Pleistozäns und frühen Holozäns. Die Grüne Sahara war eine Region mit fragmentierter Umwelt und vielfältigen ökologischen Nischen, die vermutlich eine komplexe soziale und kulturelle Netzwerkbildung begünstigte. Dennoch blieben zahlreiche Genflüsse über die große Wüstenlandschaft hinweg begrenzt, vielleicht auch bedingt durch soziale Tabus, kulturelle Eigenheiten und physische Herausforderungen. Diese Erkenntnisse setzen Maßstäbe für zukünftige Forschungen und heben hervor, wie wichtig genetische Daten sind, um archeologische Interpretationen zu ergänzen und zu präzisieren. Langfristig bieten die gewonnenen Erkenntnisse nicht nur eine neue Perspektive auf die Archäogenetik Nordafrikas, sondern auch auf die allgemeine Menschheitsgeschichte.
Die Verbindung zwischen der Iberomaurusischen Kultur in Marokko und populären Neolitikum-Gruppen in der Grünen Sahara zeigt, dass sich kulturelle Praktiken über große Distanzen verbreiteten, auch wenn eine umfassende genetische Durchmischung ausblieb. Dies hat Auswirkungen auf das Verständnis von Bevölkerungsbewegungen, kulturellen Innovationen und den Umgang mit Umweltveränderungen bei frühen menschlichen Gemeinschaften. Die Studie nutzt modernste genetische Analysemethoden, darunter Gen-Capture-Techniken für selten erhaltene alte DNA-Fragmente, komplexe Populationsanalogien mithilfe von Statistiksoftware, sowie mitochondriale DNA-Datierungen, um Verwandtschaftsverhältnisse und Ursprungslinien zu bestimmen. Die Ergebnisse stellen damit einen wichtigen Fortschritt in der Archäogenetik dar und sind ein exemplarisches Beispiel für interdisziplinäre Forschung, die Archäologie, Genetik, Paläoklimatologie und Anthropologie verbindet. Für die Zukunft eröffnen diese Resultate spannende Möglichkeiten.
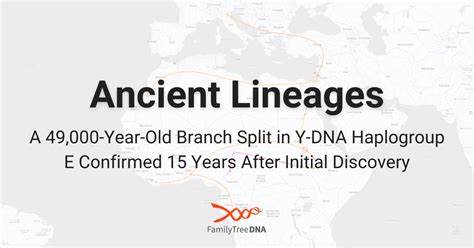


![What happens when you take an older adult on a trishaw ride? – JOYRIDE (PBS) [video]](/images/85E240D3-0335-40CC-9385-4D824BC9A743)