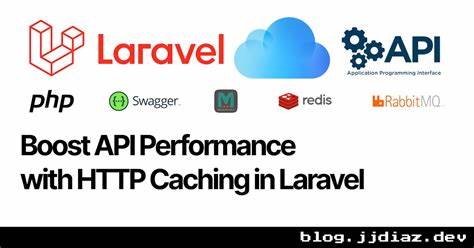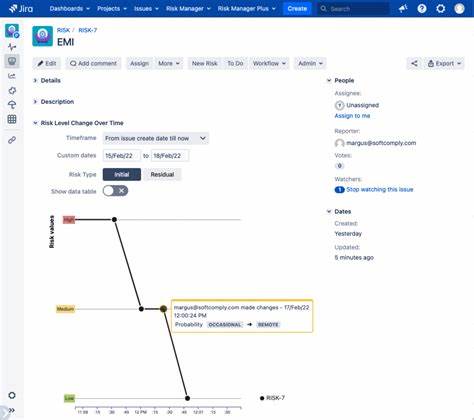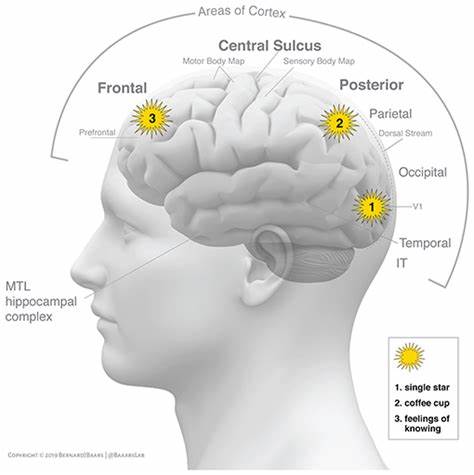In der heutigen digitalen Welt sind leistungsfähige Backend-Systeme unerlässlich, um die stetig wachsenden Anforderungen von Nutzern und Anwendungen zu bewältigen. Besonders bei Echtzeitanwendungen oder solchen mit häufigen Datenaktualisierungen kann die Belastung der API-Endpunkte schnell zum Flaschenhals werden. Eine ineffiziente Architektur, die auf redundante Anfragen von Benutzern angewiesen ist, kann nicht nur die Performance verschlechtern, sondern auch die Kosten durch übermäßige Servernutzung in die Höhe treiben. Genau vor einer solchen Herausforderung stand ich, als ich die Last auf mein Backend-API überdenken musste. Mein Ziel war klar: eine nachhaltige Reduzierung der Backend-Anfragen um mindestens 90 % bei gleichzeitiger Steigerung der Nutzerdatenaktualität und Reaktionsschnelligkeit.
Das Problem bestand darin, dass meine Anwendung Live-Daten anzeigte, die sich zwar in bestimmten Intervallen aktualisierten, aber für alle Benutzer identisch waren. Ich setzte ursprünglich auf ein klassisches Polling-Verfahren. Nutzer riefen vier verschiedene API-Endpunkte in unterschiedlichen Intervallen ab, wobei alle Aufrufe innerhalb von zehn Sekunden stattfanden. Das führte zu etwa 1,2 Anfragen pro Sekunde pro Nutzer. Solange die Nutzerzahl begrenzt war, funktionierte das System einwandfrei.
Doch mit steigendem Nutzerverkehr wurde schnell ersichtlich, dass das Backend auf einem kleinen EC2-Server (t2.micro) immer mehr an seine Grenzen stieß. Die Rechenleistung und der verfügbare Arbeitsspeicher reichten kaum aus, um den Massenzugriff zu bewältigen. Hinzu kam, dass das Backend auch andere essentielle Aufgaben wahrnahm, wie die Authentifizierung der Nutzer, wodurch die Gesamtperformance zusätzlich beeinträchtigt wurde. Ein zentrales Problem bei dem bestehenden Modell lag in der Redundanz der Anfragen.
Tausende von Clients stellten dieselben Anfragen immer wieder, obwohl sich die zugrunde liegenden Daten zu diesem Zeitpunkt kaum geändert hatten. Diese überflüssigen API-Calls führten dazu, dass der Server unnötig belastet wurde, Resourcenkapazitäten verloren gingen und die Latenzzeiten für echte Operationen anstiegen. Vor diesem Hintergrund begann ich, alternative Architekturen zu erforschen, um die Effizienz meines Systems zu steigern. Mein Lösungsansatz basierte auf einem Grundprinzip: die Eliminierung redundanter Anfragen durch eine Zwischenarchitektur. Da sich die abgefragten Daten zwischen den Nutzern nicht unterscheiden, konnte ich eine Schicht implementieren, die als zentraler Poller agierte.
Statt tausender Nutzer sollten nur noch wenige oder sogar nur eine Komponente direkt mit dem Backend kommunizieren. Dieses speziell programmierte Polling-Mikroservice übernahm die Aufgabe, die API in regelmäßigen Intervallen abzufragen und die aktuellen Daten in einem schnellen Cache-System abzulegen. Redis eignete sich dafür aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit und seines geringen Overheads hervorragend. Die Architektur setzte sich aus mehreren Komponenten zusammen. Der Polling-Mikroservice, implementiert in Java, übernahm das direkte Abfragen der API-Endpunkte mit derselben Frequenz, die zuvor der Durchschnitt aller Client-Anfragen ausmachte.
Dadurch wurde der Backend-Traffic auf ein konstantes und kontrolliertes Niveau reduziert, das sich selbst bei steigender Zahl der Nutzer nicht mehr veränderte. Die so erhaltenen aktuellen Daten speicherte der Poller in Redis. Um sicherzustellen, dass die Clients möglichst zeitnah über neue Daten informiert werden konnten, nutzte ich das Pub/Sub-System von Redis. Jeder neue Satz von aktualisierten Daten wurde in einem dafür vorgesehenen Kanal veröffentlicht. Die Herausforderung bestand jedoch darin, dass Redis nicht direkt mit den Clients über HTTP kommunizieren konnte, insbesondere wenn es um Technologien wie Server-Sent Events (SSE) ging, die eine dauerhafte Verbindung erfordern.
Die Lösung lag in einer zwischengeschalteten HTTP-Serverinstanz, die die Clients bediente. Diese wurde mit Express.js umgesetzt und hatte die Aufgabe, SSE-Verbindungen zu verwalten, Nachrichten von Redis-Pub/Sub zu empfangen und sie in Echtzeit an die verbundenen Clients weiterzuleiten. Auf diese Weise entstanden keine unnötigen HTTP-Anfragen an das Backend mehr, stattdessen nutzten alle Nutzer eine Datenstrom-Architektur, bei der sie sofort über Updates informiert wurden. Der Vorteil dieses Systems liegt auf der Hand.
Anstelle tausender Nutzer, die unabhängig voneinander mit der Backend-API kommunizieren und so die Serverressourcen erschöpfen, existiert nun eine einzige, spezialisierte Komponente, die die Last bündelt und steuert. Redis dient als ultraflacher Speicher für die Daten, die Tausenden von Nutzern gleichzeitig schnell zur Verfügung gestellt werden können, ohne dass die Leistung darunter leidet. Außerdem sorgt die Pub/Sub-Publikation dafür, dass die Nutzer nicht mehr ständig selbst nach neuen Daten fragen müssen, sondern automatisch informiert werden, sobald sich diese ändern. Das Ergebnis ist eine extrem reduzierte Serverlast und eine verbesserte Reaktionszeit für den Endanwender. Das Caching durch Redis ist in diesem Kontext besonders bedeutsam.
Es erfüllt zwei Hauptaufgaben: Zum einen stellt es sicher, dass neue Kunden, die sich verbinden, sofort die aktuellsten Daten angezeigt bekommen, ohne auf das nächste Update warten zu müssen. Zum anderen kann es bei einem Ausfall des Polling-Mikroservice als Puffer dienen, der die letzten gültigen Daten bereitstellt und so eine gewisse Ausfallsicherheit ermöglicht. Ohne die Zwischenspeicherung könnten Benutzer in solchen Ausnahmesituationen mit verzögerten oder gar keinen Daten konfrontiert werden. Natürlich gibt es bei dieser Architektur auch Kompromisse. Die Einführung zusätzlicher Komponenten erhöht die Komplexität und den Wartungsaufwand beträchtlich.
Das System ist nun verteilt, was Monitoring, Logging, Fehlerbehandlung und Updates auf mehrere Dienste ausweitet. Diese zusätzlichen Ebenen erfordern ein gewisses Maß an Infrastrukturmanagement sowie automatisierte Deployment-Prozesse und eine engmaschige Überwachung. Sollte es zu Problemen kommen, ist die Fehlersuche tendenziell anspruchsvoller, da man sowohl den Status des Caches, die Gesundheit des Pollers als auch die Stabilität der HTTP-SSE-Verbindungen überprüfen muss. Alternative Ansätze, die ich in Betracht zog, zeigten unterschiedliche Vor- und Nachteile. Zum Beispiel das direkte Polling der Redis-Daten von den Clients schien zunächst eine einfache Lösung zu sein.
Zwar wurde die Last auf das Backend reduziert, jedoch stiegen dadurch die Anfragen an die Redis-Datenbank exponentiell und verursachten erhöhte Kosten bei einem cloudbasierten Dienst. Ein weiteres interessantes Konzept war die Verwendung von Event-Streaming-Technologien wie Apache Kafka. Damit ließen sich komplexe Ereignisströme und Echtzeit-Updates effizient verarbeiten, allerdings stellte sich heraus, dass die initialen Daten beim Verbindungsaufbau fehlten und die Datenformatierung für die Frontend-Nutzung zusätzliche Komplexität erzeugte. Auch dadurch wurde die Implementierung unübersichtlicher und aufwändiger. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine gezielte Optimierung der Backend-Kommunikation durch einen dedizierten Poller, gekoppelt mit einem schnellen Cache-System und einem eventbasierten Verteiler, die Backend-Last drastisch senken kann.
Die Nutzung von Redis in Kombination mit Server-Sent Events bietet eine elegante Möglichkeit, Echtzeitdaten effizient und skalierbar an viele Nutzer zu verteilen. Für Entwickler, die mit Skalierungsproblemen und redundanten API-Anfragen kämpfen, eröffnet ein solcher Ansatz neue Perspektiven. Wichtig ist jedoch, dass diese Architektur nicht für jede Anwendung gleichermaßen passt. Jeder Anwendungsfall muss individuell bewertet werden, um den optimalen Kompromiss zwischen Einfachheit, Performance und Betriebskosten zu finden. Die Einführung zusätzlicher Dienste verlangt einen gewissen Aufwand an Wartung und Stabilitätssicherung.
Dennoch ist es eine lohnenswerte Investition, die Sicherheit und Skalierbarkeit für den wachsenden Nutzerstamm gewährleistet. Für alle Entwickler und Architekten, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen, empfehle ich, die eigenen Datenflüsse kritisch zu analysieren und Möglichkeiten der Zentralisierung und Event-orientierten Kommunikation auszuloten. Oft führt die Reduktion redundanter Anfragen und die Nutzung von Cache und Pub/Sub-Systemen zu einer deutlich verbesserten Systemperformance, besserer Nutzererfahrung und niedrigeren Betriebskosten. Die richtige Architektur entscheidet in vielen Fällen maßgeblich über den langfristigen Erfolg einer Anwendung und die Zufriedenheit der Nutzer.