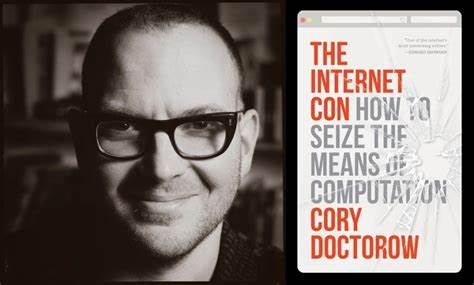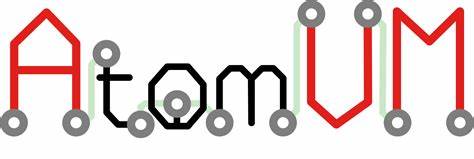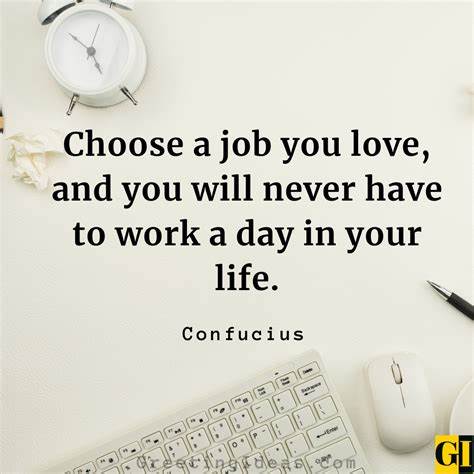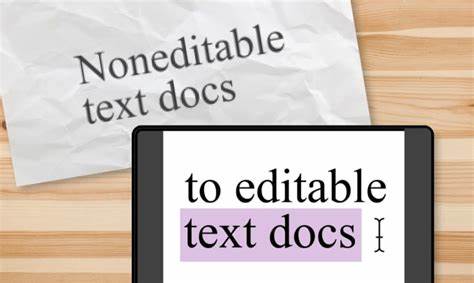Das Internet war einst ein Versprechen – ein Raum der Freiheit, der Innovation und der offenen Kommunikation. Doch heute erleben wir vielfach das Gegenteil: monopolistische Plattformen, Überwachungskapitalismus und eine zunehmende Kommerzialisierung, die Nutzer und Anbieter gleichermaßen ausbeutet. Cory Doctorow, ein renommierter digitaler Aktivist, Science-Fiction-Autor und Berater der Electronic Frontier Foundation, hat in seiner inspirierenden Keynote auf der PyCon US 2025 diese Entwicklungen als „Enshittifizierung“ bezeichnet – ein Prozess, der digitale Plattformen vom Nutzerwohl weg und hin zu eigeninteressierter Profitmaximierung führt. Seine Analyse bietet einen umfassenden Einblick in das, wie wir das Internet verloren haben und welche politischen Entscheidungen diese Entwicklung begünstigt haben. Doctorow beginnt seinen Vortrag mit einem Beispiel aus der Realität der Pflege: heute werden viele Schichten von Krankenpflegerinnen und -pflegern über sogenannte „Uber für Pflege“-Apps vermittelt.
Diese Plattformen agieren nicht nur als Vermittler, sondern als kartellartige Größen, die mit Algorithmen die Arbeit und Bezahlung der Pflegenden manipulieren. Besonders erschütternd ist, dass die Bezahlung von der finanziellen Notlage der Pflegekräfte bestimmt wird. Wer Verschuldung und Zahlungsrückstände hat, erhält weniger Geld angeboten. Dieses Beispiel steht symptomatisch für ein größeres Muster, das Doctorow „Enshittifizierung“ nennt, und verdeutlicht, wie technologische Möglichkeiten genutzt werden, um Arbeitskräfte systematisch auszubeuten. Der Begriff „Enshittifizierung“ beschreibt einen dreistufigen Prozess der Plattformzerstörung.
Zu Beginn optimiert ein Dienst seine Nutzererfahrung und investiert in technische Qualität, um Anhänger zu gewinnen – Google steht hier exemplarisch. Das Unternehmen finanzierte seine Dominanz, indem es andere Dienste bestach, Google als Standardsuchmaschine einzurichten. So wurden Nutzer frühzeitig an die Plattform gebunden. Im zweiten Schritt jedoch, sobald die Nutzerbindung gefestigt ist, verlagert sich der Fokus zugunsten der Geschäftskunden. Die Nutzer werden mit immer mehr Werbung und weniger hochwertigen Inhalten konfrontiert.
Google etwa überführt immer größere Anteile der Suchergebnisse in bezahlte Anzeigen, die oft kaum vom organischen Inhalt zu unterscheiden sind. Gleichzeitig sorgt die Plattform durch dito Praktiken bei Werbetreibenden und Publishern für eine weitere Verhärtung der Abhängigkeiten. Der dritte Schritt ist der Verfall: die Plattform wird maximal ausgepresst, wobei der Mindestwert erhalten bleibt, damit Nutzer und Geschäftsinteressen dauerhaft gefangen sind. Google, ein Monopolist mit über 90 Prozent Marktanteil, ist zum Sinnbild dieser Entwicklung geworden. Interne Dokumente und gerichtliche Verfahren enthüllen, dass Google bewusst seine Suchergebnisse verschlechterte, um Nutzer länger suchen zu lassen und dadurch mehr Werbung zu zeigen.
Gleichzeitig manipulierte es mit anderen Konzernen den Markt, um Einnahmen zu steigern und Publisher zu benachteiligen. Nutzer sehen heute eine Suchseite mit einem „Berg aus KI-Müll“ und kaum zu unterscheidenden Werbeanzeigen, doch sie bleiben, weil der Wechsel schwerfällt. Diese Abwärtsspirale verdeutlicht das Ausmaß der „Enshittifizierung“. Ein wesentlicher technischer Hebel dafür ist das, was Doctorow als „Twiddling“ bezeichnet: die Fähigkeit dieser Plattformen, zahllose Parameter ihrer Dienste algorithmisch und in Echtzeit anzupassen. Preise, Empfehlungen, Sichtbarkeit – alles kann dynamisch justiert werden.
Im Kontext der digitalen Gig-Ökonomie führt dies zu „algorithmischer Lohndiskriminierung“; Preise für Arbeitsstunden werden je nach wirtschaftlicher Verfassung der Nutzer angepasst, oft zugunsten der Unternehmen und zu Lasten der Beschäftigten. Uber etwa setzt einen Mechanismus ein, der Löhne zunächst anhebt, um zögernde Fahrer zu locken und dann schrittweise senkt, so dass der Mensch die Veränderungen kaum wahrnimmt. Diese Formen der digitalen Ausbeutung lassen sich nur durch automatisierte Systeme in diesem Maßstab umsetzen. Doctorow widerlegt auch das gängige Narrativ, dass wer nicht zahlt, selbst das Produkt sei. Zwar werden Nutzer bei sogenannten „kostenlosen“ Angeboten durch Überwachung und Datenhandel monetarisiert, doch er betont, dass zahlende Kundschaft keineswegs automatisch besseren Schutz und bessere Produkte erhält.
Ein Beispiel ist Apple, das mit Funktionen wie dem Opt-out bei Drittanbieter-Tracking punktet, gleichzeitig aber eigene Überwachungsnetzwerke ohne optische Zustimmung betreibt. Zudem belastet Apple Entwickler mit hohen Gebühren, was auch hier Nutzer, Anbieter und ganze Ökosysteme zu Produkten zur Gewinnmaximierung degradieren lässt. Die „Enshittifizierung“ betrifft demnach alle Beteiligten – Anwender, Anbieter und Geschäftskunden. Ein besonders ernüchternder Punkt ist, dass diese Zustände keine Folge technischer Evolution oder bösartiger Einzelakteure sind, sondern konkrete politische Entscheidungen und Weichenstellungen der letzten Jahrzehnte. Doctorow verweist auf politische Entwicklungen insbesondere seit den 1980er Jahren, als die Interpretation von Kartellrecht in den USA und ihren wichtigsten Handelspartnern verändert wurde.
Monopole wurden als effizient angesehen, was die Konzentration und Übernahmen gigantischer Unternehmen begünstigte. Statt Wettbewerb herrscht heute oft Übernahmenzwang – wie Mark Zuckerberg in eigenen Memos beklagte, ist es „besser zu kaufen als zu konkurrieren“. Diese Einstellung wurde von Regierungen aller Couleur getragen und führte zu einer Monopolisierung in zahllosen Branchen, inklusive Technologie. Zudem wurde die Regulierung durch „Regulatory Capture“ massiv untergraben. So erklärt sich, dass in den USA seit 1988 keine umfassenden Datenschutzgesetze mehr verabschiedet wurden, obwohl datenschutzrechtliche Probleme längst erkennbar sind.
Die Wirtschaft hat es umsatzstark genutzt, den systematischen Missbrauch der Privatsphäre zu kommerzialisieren und politisch zu verhindern, dass Nutzer ausreichend geschützt werden. Das Wettrüsten dieser Unternehmen beruht auf einem fragilen Sockel regulatorischer Vernachlässigung, unterstützt durch gezielte Lobbyarbeit und politische Inaktivität. Neben Wettbewerb und Regulierung diskutiert Doctorow auch die Bedeutung von Interoperabilität. Im digitalen Bereich ist alles potentiell kompatibel, da alle Programme auf der gleichen universellen Rechnerarchitektur laufen. Wo Hersteller versuchen, Schnittstellen absichtlich zu blockieren, greifen Spezialisten zu technischen Gegenmaßnahmen - beispielsweise Apps, die verborgene Daten sichtbar machen.
Doch selbst solche legalen Mittel werden durch Gesetze wie den Digital Millennium Copyright Act (DMCA) kriminalisiert, welche das Umgehen digitaler „Schlösser“ verbieten. Länder in Europa, Kanada und anderen Regionen haben ähnliche Regelungen eingeführt, oft unter Druck der USA. Diese digitale Verpackung als Schutz von Urheberrechten wird zu einer weiteren Schutzmauer für Monopole, die den Zustand der „Enshittifizierung“ verstärkt. Arbeitskräfte in der Tech-Branche waren lange Zeit der letzte Schutz vor diesem Verfall. Die beste technische Expertise war knapp und verlangte gute Bedingungen.
Doch die Massenentlassungen in der Tech-Industrie seit 2023 haben diese Macht geschwächt. Mit vielen Arbeitssuchenden ist der Widerstand gegen destruktive Forderungen der Arbeitgeber geschrumpft und die Dynamik hin zu schlechteren Produkten und Prekarisierung verstärkt sich. Die bisher vielbeschworene Solidarität und Fachkräfteknappheit haben Plattformen so weiter in die „Enshitternet“-Zukunft entlassen. Der Vortrag schließt trotz düsterer Bestandsaufnahme mit einem Hoffnungsschimmer. Es sei nicht die unvermeidbare Folge technischer Entwicklung, sondern politischer Entscheidungen, die geändert werden könnten.
Weltweit erleben wir aktuell eine Wiederbelebung von Antimonopolgesetzen und breit angelegte Initiativen – sowohl von linker als auch rechter Seite. Europa, Kanada, Japan, Südkorea, China und weitere Länder setzen Regulierungen durch, die Monopole herausfordern und Rahmenbedingungen ändern. Auch das Recht auf Reparatur erfährt zunehmende Unterstützung, wenngleich Gesetze zum Schutz von Digitaler Rechteverwaltung (DRM) einen Rückschlag darstellen. Doctorow schlägt eine Strategie vor, die auf Offenheit, Interoperabilität und faire Wettbewerbsmärkte setzt. Er imaginiert Länder, die durch Aufhebung restriktiver Gesetze und Förderung von offenen Alternativen die Dominanz der US-amerikanischen Tech-Giganten brechen könnten.
Das Schaffen von günstigen App-Stores mit geringeren Gebühren, die Legalisierung des „Jailbreakens“ von Software und Hardware sowie erleichterte Reparaturmöglichkeiten könnten flächendeckend ein Gegengewicht aufbauen. So könnten nicht nur die Preise sinken, sondern auch die Vielfalt, Innovation und Nutzerfreundlichkeit steigen. Seine Vision eines neuen, guten Internets verbindet technische Selbstbestimmung und Nutzerfreundlichkeit, vergleichbar mit dem ursprünglichen Internet, jedoch einfacher und inklusiver durch moderne Web 2.0-Technologien. Dieses Internet solle eine digitale Öffentlichkeit bieten, die es ermöglicht, gesellschaftliche Herausforderungen anzupacken und zu bewältigen wie Klimawandel, Demokratieerhaltung und Menschenrechte.