In der heutigen Kultur erleben wir eine grundlegende Veränderung des Begehrens, die weit über oberflächliche Konsummuster hinausgeht. Das traditionelle Verlangen, wie es in philosophischen und religiösen Traditionen verstanden wurde, ist nicht verschwunden – es hat sich in eine neue Form verwandelt, die durch sofortige Befriedigung, Überstimulation und den Verlust von Tiefe und Symbolik gekennzeichnet ist. Diese Veränderung lässt sich am besten durch das Konzept der „pornografischen Vernunft“ verstehen, ein Begriff, der von Hussein Aboubakr Mansour geprägt wurde, um die umfassende kulturelle und epistemologische Transformation unserer Zeit zu beschreiben. Der Begriff „pornografische Vernunft“ ist dabei weit mehr als die bloße Beschreibung sexueller Darstellungen oder eines gesteigerten Maßes an Obszönität. Er verweist auf eine Denkweise und eine Lebensform, in der das Verborgene abgeschafft und durch die sofortige Sichtbarkeit sowie uneingeschränkte Verfügbarkeit aller Dinge ersetzt wurde.
Diese neue Ordnung stellt nicht die Überwältigung durch das Eros in den Mittelpunkt, sondern die Auflösung dessen, was zuvor durch Verschleierung, Mediationsformen und symbolische Bedeutung geformt wurde. Die moderne Auffassung von Wahrheit und Realem ist geprägt von einer Gleichsetzung von Sichtbarkeit und Realität. Was nicht unmittelbar wahrgenommen oder sichtbar gemacht werden kann, gilt als falsch, unecht oder hinterlistig. Dies stellt einen radikalen Bruch zu den epistemologischen Grundsätzen der abrahamitischen Traditionen dar. Judentum, Christentum und Islam lehrten, dass Wahrheit niemals vollumfänglich zugänglich oder unverschleiert sei, sondern dass das Wesentliche sich nur durch Rituale, Zeichen oder Worte offenbare – stets strukturiert durch Vermittlung und teilweise Verhüllung.
Diese symbolische „Verhüllung“ war dabei nicht Mangel, sondern Voraussetzung für Erkenntnis und erfüllte die Aufgabe, die menschliche Begegnung mit dem Überirdischen, dem Heiligen und dem Unbegreiflichen zu ermöglichen. Indem diese Strukturen verloren gegangen sind, hat die moderne Gesellschaft nicht nur ihre Weltanschauung umgestürzt, sondern auch jene Formen der Begehrens, des Verlangens, die Identität und Kultur prägen. Verlangen in seinem tiefsten Sinn ist weit mehr als das unmittelbare Bedürfnis oder das konsumistische Verlangen nach Freude und Befriedigung. Es ist eine zielgerichtete Bewegung des Selbst hin zum Guten, das sich niemals vollständig besitzt, sondern stets in der Ferne bleibt und daher das Streben und die Bildung des Subjekts bedingt. Diese Fähigkeit zum Verlangen, das sich zurückhalten, aufsparen, sublimieren kann, formt das innere Leben und die kulturellen Konturen einer Gesellschaft.
Bereits Aristoteles hob hervor, dass die Ethik darin besteht, das Verlangen richtig zu richten und diesen Prozess durch Vernunft und Tugend zu ordnen. In der christlichen und islamischen Moraltheologie fand diese Idee ihre Entsprechung in der Reinigung und Ausrichtung der Seele an höheren, göttlichen Zielen. Mit dem kulturellen Wandel der Neuzeit änderte sich jedoch diese tief verwurzelte Struktur. Ausgangspunkt war die Kritik an traditionellen, symbolisch-vermittelten Autoritäten, wobei säkulare Aufklärung und Wissenschaft eine unmittelbare, ungeschützte Sichtbarkeit anstrebten. Das Zeitalter der „Endmoräne“ aller Traditionen, das Gefühl, als „das Letzte“ oder gar als das Ende der Geschichte und Kultur zu leben, führte zu einem Überschuss an freiem Zugriff auf alle Informationen, Bilder und Bedeutungen.
Gleichzeitig kam die Ebene der Interaktion, des echten Begehrens und der symbolischen Vermittlung ins Wanken. Die Konsequenz ist das, was Mansour als den „post-sublimen“ Zustand beschreibt — eine Situation, in der die Welt nicht vor Verlust an Bedeutung durch Leere leidet, sondern durch deren Überfluss und Verfügbarkeit vernichtet wird. Das Verlangen verliert in diesem Kontext seine vertikale Achse, die es mit dem Transzendenten verbindet – es wird zu einer horizontalen Schleife von permanentem Konsum und Überstimulation. Wo früher Verlangen Geduld, Distanz, das Spiel des Verbergens und Zeigens verlangte, herrschen heute sofortige Befriedigung und mechanische Wiederholung. Dieses Modell entspricht einer pornografischen Mode des Umgangs mit der Welt, in der nichts mehr verhüllt, sondern alles auf Oberfläche reduziert wird.
Der Begriff „pornografisch“ im Sinne von Mansour umfasst dabei nicht nur sexuelle Überexposition, sondern eine generelle Entleerung von Tiefe und Sinn in allen Lebensbereichen – sei es Politik, Wissen, Kunst oder zwischenmenschliche Beziehungen. Es handelt sich um eine Logik, die aus der völligen Transparenz nicht Erkenntnis, sondern eine Infektion der Seele macht. Ebenso dramatisch ist die Umkehrung des Sinnes von Wissen und Wahrheit. Wo vormals Erkenntnis eine demütige, geregelte Annäherung an etwas Unbekanntes und Größeres war, hat sich das Wissen in reine Information verwandelt – unmittelbare, jederzeit verfügbare Datenfragmente, die keine symbolische Vermittlung, keine langwierige Interpretation und keine geduldige Transformation mehr erfordern. Diese Informationsgesellschaft beschleunigt nicht das Verstehen, sondern erschöpft das Vermögen zur Kontemplation.
Wahrheit wird zu dem, was sichtbar, präsent und „auffindbar“ ist, während das Verborgene, das Verdeckte als verdächtig oder unecht gilt. Daraus resultiert die Gleichsetzung von Transparenz mit Ehrlichkeit und Undurchsichtigkeit mit Täuschung. Diese Entstrukturierung wirkt sich tiefgreifend auf die menschliche Identität und die Kultur aus. Persönlichkeit formt sich durch das Innere der symbolischen Ordnung und die Fähigkeit, mit begrenzendem Verbot, Verzögerung und Raum zu leben. Solche Begrenzungen bilden die Grundlage für eine stabile Psyche und eine funktionierende Gesellschaft.
Die Abschaffung dieser Grenzen, die der therapeutischen Kultur des „jetzt sofort“ zugeordnet werden kann, führt zu einer Kultur der Entgrenzung, in der das Verlangen sich entweder in wahllose Zirkulation von Reizen auflöst oder in Langeweile und Desorientierung erstarrt. In der psychologischen Terminologie ist das kein moralischer Verfall, sondern ein Zerfall der vorprägenden Strukturen, die Subjektivität und Sinn hervorgebracht haben. Die klassische Erzählung des Faust wird in diesem Zusammenhang besonders bedeutsam. In Goethes Drama steht Faust für das moderne Subjekt, das alles Wissen der Vernunft erlangt hat und dennoch in seiner Existenz verzweifelt. Er sucht nicht mehr das Gute oder Wahre, sondern rast nach Bewegung, nach Reiz ohne Maß und Halt.
Sein Pakt mit Mephistopheles symbolisiert die Hingabe an eine unendliche Beschleunigung und Sättigung, eine Kultur ohne Pause und ohne Transzendenz. Fausts Weg steht für den Übergang von der vernunftorientierten, sinnhaften Existenz zu jener der unablässigen Stimulation, die Mansour als pornografische Vernunft beschreibt. Während Faust – so lässt sich sagen – trotz seiner Verzweiflung noch im Schatten eines symbolischen Systems steht, ist die heutige Generation bereits weiter entfernt. Wo Faust nach der Schönheit und dem Schmerz des Verlangens strebte, ist heute die Fähigkeit zur Geduld, zum Warten und zur Verehrung längst verblasst. Moderne Begehren verlangt nicht mehr das Ferne und Verhüllte, sondern die sofortige Explosion von Bildern und Eindrücken, stets weiter, immer schneller, um nicht von Leere übermannt zu werden.
Die Folge ist eine unersättliche Besessenheit vom Neuen und ein Verlust dessen, was Substanz und Tiefe ausmacht. Der Verlust der symbolischen Ordnung und die allgemeine Sättigung durch Oberflächen erzeugen nicht nur kognitive Defizite, sondern verändern auch die moralische und soziale Praxis. Politik wird zur öffentlichen Show, in der Signale und Effekte über Wahrheiten siegen. Gemeinschaft verwandelt sich in algorithmisch-gesteuerten Affektkonsum, bei dem echte Begegnung durch oberflächliche Partizipation ersetzt wird. Kunst und Wissen verlieren ihr vermittelndes Potenzial und werden zu bloßen Produkten eines fortwährenden Stroms von Reizen.
Die Herausforderung dieser Gegenwart liegt darin, sich der Folgen des post-sublimen Zustands bewusst zu werden und nach neuen Wegen zu suchen, in denen Verlangen und Erkenntnis nicht bloß konsumiert, sondern wieder erfahren, geformt und geliebt werden können. Es geht um die Rekonstruktion einer symbolischen Architektur, die Verhüllungen nicht als Hindernis, sondern als Bedingung der Begegnung deutet. Der Schleier ist kein Feind, sondern das Mittel, durch das die Tiefe des Lebens spürbar wird. In einer Zeit, in der der horizontale Strom von Bildern als maßgebliches Erlebnis herrscht, liegt eine Aufgabe darin, erneut die vertikale Dimension des Begehrens zu kultivieren – das Verlangen, das nicht auf sofortige Erfüllung zielt, sondern auf Erhabenheit, Geduld, und die Sehnsucht nach dem, was immer jenseits der voll sichtbaren Welt liegt. Nur so kann einer Kultur, die sich in der „pornografischen Vernunft“ verliert, ein neues Fundament gegeben werden, auf dem Mysterium, Stille und symbolische Vermittlung wieder Raum finden.
Die Rückkehr zum Erhabenen fordert deshalb eine kultivierte Haltung der Askese gegenüber der Überflutung, eine bewusste Gestaltung des inneren Raumes der Seele und die Einsicht, dass gewisse Dinge nicht sofort konsumiert, sondern nur unter Bedingungen der Mediation verstanden werden können. In diesem Sinne ist das Sehnen nach dem Sublimen kein nostalgischer Wunsch, sondern eine existentielle Notwendigkeit. Es ist der Versuch, dem Diktat der Oberfläche zu entkommen, um die Tiefenschichten menschlicher Erfahrung wieder zu betreten und mit dem Verschwinden der Trennung zwischen Erscheinung und Wahrheit aufzuräumen. Abschließend lässt sich sagen, dass das gegenwärtige Verlangen in seiner pornografischen Ausprägung ein Indikator für eine viel fundamentale Krise des Menschen und seiner Kulturen ist. Es zeigt, dass die Errungenschaften der Moderne, vor allem die Entzauberung des Weltbildes und die Auflösung tradierten Begehrens, in eine Sackgasse führen können, in der das Selbst sich verliert und das Leben selbst zur bloßen Oberfläche verkommt.
Die Herausforderung besteht darin, Wege zu finden, neue Formen von Sublimation und symbolischer Vermittlung zu schaffen, die das Verlangen wieder in eine Bewegung verwandeln, die über den reinen Konsum hinausgeht und Identität, Kultur und Sinn ins Leben zurückbringt.




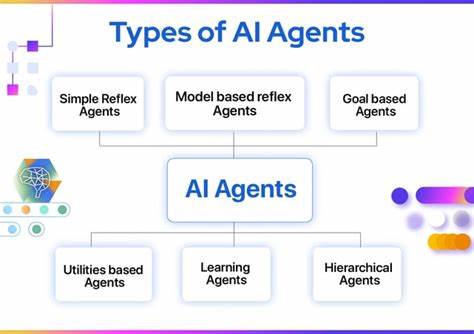

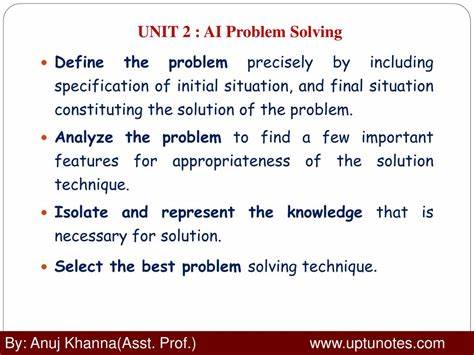
![Results summary: 2025 Annual C++ Developer Survey "Lite" [pdf]](/images/AD6BD859-2F0B-4D38-9A34-EC5AC0D9AF1E)

