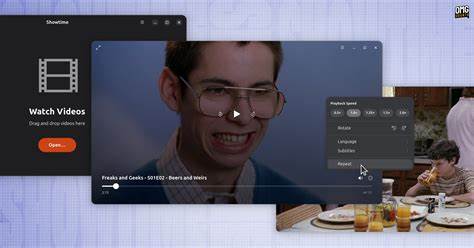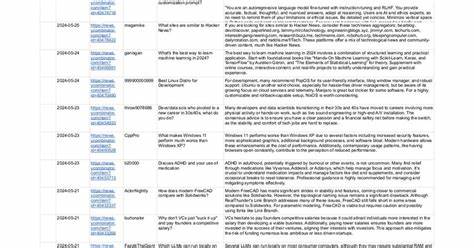In einer Zeit, in der die USA erhebliche Kürzungen bei der Finanzierung wissenschaftlicher Forschung erleben, setzt Europa mit dem Programm "Choose Europe for Science" ein starkes Zeichen, um internationale Spitzenforscher gezielt anzuziehen. Die Initiative wurde von der Europäischen Kommission ins Leben gerufen und sieht eine Investition von 500 Millionen Euro zwischen 2025 und 2027 vor, um Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen, insbesondere aus den Vereinigten Staaten, für die EU-Länder zu gewinnen. Hintergrund dieser Bemühungen sind die massiven Einschnitte, die besonders unter der Trump-Administration in den USA vorgenommen wurden, und die dadurch ausgelösten Unsicherheiten in der Forschungsgemeinschaft. Die Auswirkungen der US-Forschungskürzungen sind weitreichend und betreffen nicht nur einzelne Institutionen, sondern ganze wissenschaftliche Fachgebiete. So steht etwa ein Team des National Institute of Standards and Technology (NIST), das für grundlegende Messdaten in Bereichen wie Astrophysik, Kernfusion und Halbleitertechnologie verantwortlich ist, vor der möglichen Auflösung.
Solche Entwicklungen gefährden nicht nur den wissenschaftlichen Fortschritt der USA, sondern bieten Europa zugleich die Gelegenheit, sich als attraktiver Wissenschaftsstandort zu positionieren. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, betont in ihrer Stellungnahme die elementare Bedeutung der Wissenschaft für die Bewältigung globaler Herausforderungen und kritisiert die rückläufige Wertschätzung von Grundlagenforschung in den USA. Sie sieht die Wissenschaft als universelles und verbindendes Element, dessen Förderung für die Zukunftsfähigkeit Europas unverzichtbar ist. Mit dem Programm "Choose Europe for Science" untermauert Europa seinen Anspruch, ein führendes Zentrum für kreative und innovative Forschung zu bleiben beziehungsweise zu werden. Ein besonderes Merkmal des Programms ist die Einführung einer sogenannten "Super-Grant"-Förderung, die Forschenden sieben Jahre langfristige finanzielle Stabilität sichern soll.
Diese Maßnahme soll der gängigen Unsicherheit in der wissenschaftlichen Laufbahn entgegenwirken und exzellente Forscher an Europa binden. Zudem wird der finanzielle Anreiz für Wissenschaftler, die ihren Karriereweg in der EU fortsetzen wollen, deutlich erhöht – die Gelder für Zuzügler werden in diesem Jahr verdoppelt. Zusätzlich ist geplant, den Anteil der Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) auf drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts bis 2030 zu steigern. Diese strategische Investition soll vor allem die Grundlagenforschung sowie die Entwicklung neuer, technologiegetriebener Branchen fördern. Die Kombination aus langfristiger finanzieller Unterstützung, einem transparenten Wissenschaftssystem und nachhaltiger Infrastruktur umfasst die wesentlichen Komponenten, die Europa für die Forschungsgemeinschaft attraktiv machen sollen.
Trotz dieser vielversprechenden Entwicklung gibt es auch Herausforderungen. Laut von der Leyen ist die europäische Forschungslandschaft mit einer komplexeren Bürokratie konfrontiert als andere Regionen weltweit. Insbesondere die Verzahnung von Grundlagenforschung und wirtschaftlicher Anwendung verläuft nicht in dem Tempo, das für wettbewerbsfähige Innovationen notwendig wäre. Diesem Umstand soll künftig mit der geplanten neuen Gesetzgebung zum Europäischen Forschungsraum entgegengewirkt werden, die Forschungsfreiheit festigen und administrative Hürden minimieren soll. Die Zahl der Forschenden in Europa ist bereits beachtlich: Rund zwei Millionen Wissenschaftler arbeiten derzeit auf dem Kontinent, was etwa einem Viertel der weltweiten Forschergemeinde entspricht.
Die EU verwaltet zudem das umfangreichste internationale Forschungsförderprogramm, Horizonte Europa, mit einem finanziellen Volumen von über 93 Milliarden Euro. Kanzlerziel des Programms ist es, weiterhin weltweit führende Grundlagenforschung zu fördern und europaweit Technologieentwicklung zu beschleunigen. In den letzten vier Jahrzehnten konnten mit EU-Förderprogrammen unter anderem 33 Nobelpreisträger unterstützt werden, ein Indiz für die Qualität der Forschung. Parallel zu den Bemühungen der EU intensivieren einzelne Mitgliedstaaten ihre Attraktivitätsmaßnahmen. Frankreich etwa hat mit der Universität Aix-Marseille das Programm "Ein sicherer Ort für die Wissenschaft" ins Leben gerufen, das speziell Wissenschaftlern aus den USA Zuflucht bietet, die von dortiger Zensur oder Entlassungen betroffen sind.
Mit einer dreistelligen Millionensumme wird das Programm finanziell ausgestattet, um Forschenden auch in prekären Situationen eine Perspektive zu bieten. Deutschland verstärkt seine Kooperationen über den Atlantik und fördert mit dem Max-Planck-Programm gemeinsame Forschungszentren, die transatlantische Partnerschaften erleichtern. Die strategische Ausrichtung zielt darauf ab, gegenseitige Synergien zu nutzen und den internationalen Erfahrungs- und Wissensaustausch zu intensivieren. Spanien tritt ebenfalls entschlossen auf, um eine Schlüsselrolle bei der Talentakquise zu übernehmen. Mit deutlich aufgestockten staatlichen Fördermitteln für Programme wie das nationale Talentförderprogramm und das Ramón-y-Cajal-Programm sollen insbesondere Wissenschaftszweige wie Biotechnologie, Künstliche Intelligenz, Materialwissenschaften und Halbleiterforschung gestärkt werden.
Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Integration von Forschern aus den USA, die sich durch die politischen und finanziellen Einschränkungen in ihrem Heimatland benachteiligt fühlen. Die spanischen Zuschüsse erhöhen sich auf bis zu einer Million Euro pro Wissenschaftler, begleitet von weiterem finanziellen Support für konsolidierte Projekte im Rahmen des Programms ATRAE. Diese Maßnahmen sollen zum einen die finanzielle Attraktivität erhöhen, zum anderen aber auch ideelle Unterstützung und Freiräume für unabhängige Forschung bieten. Die statistischen Daten belegen den Wandel im globalen Wissenschaftsmobilitätsverhalten. Während sich das Interesse von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Kanada, China und Europa verringert, in den USA zu forschen (mit Rückgängen zwischen 13 und 41 Prozent bei Bewerbungen), steigt die Anzahl der US-amerikanischen Forschenden, die international Arbeitsmöglichkeiten suchen, signifikant an.
Dies spiegelt eine tiefgreifende Veränderung im globalen Wissenschaftsgefüge wider, die zugleich Chancen und Herausforderungen für Europa bereithält. Die europäischen Anstrengungen, exzellente Forscher aus den USA und anderen Teilen der Welt anzuziehen, sind Teil einer umfassenden Strategie zur Sicherung der Innovationsführerschaft und des wirtschaftlichen Fortschritts. Dabei spielt die Schaffung eines Umfelds eine zentrale Rolle, das wissenschaftliche Freiheit, stabile Karriereperspektiven und exzellente Infrastruktur auf internationalem Spitzenniveau bietet. Nur so kann Europa Forschende überzeugen, die vor allem auch in der Lage sind, über Grenzen hinweg langfristige Kooperationen einzugehen und neue Technologien hervorzubringen. Gesamtgesellschaftlich kann diese Politik langfristig nicht nur den Wissensstand Europas erhöhen, sondern auch ökonomische Impulse erzeugen, die über die reine Wissenschaft hinausreichen.
Innovationen, die aus modernster Forschung entstehen, münden häufig in neue Industrien und schaffen hochqualifizierte Arbeitsplätze, die wiederum zum Wohlstand und zur Wettbewerbsfähigkeit beitragen. Die Zeit ist günstig für Europa, eine Vorreiterrolle im globalen Wissenschaftswettbewerb zu übernehmen. Die bisherige Forschungskultur mag von einigen Einschränkungen geprägt sein, doch der Wille zu Reformen und Investitionen bietet die Chance, Barrieren abzubauen und Wissenschaftler langfristig für den europäischen Kontinent zu begeistern. Mit Programmen wie "Choose Europe for Science" setzen die EU und ihre Mitgliedstaaten ein starkes Signal, das weit über den akademischen Bereich hinaus Wirkung entfalten kann. Es bleibt spannend zu beobachten, wie sich die internationalen Wissenschaftslandschaften im Kontext geopolitischer Veränderungen weiterentwickeln und welchen Beitrag Europa im Rennen um Talente, Innovationen und globale Herausforderungen einnehmen wird.
Der Weg Europas, den Forschenden nachhaltige Perspektiven sowie finanzielle und ideelle Unterstützung zu bieten, ist vielversprechend und könnte maßgeblich die Zukunft der Wissenschaft prägen.