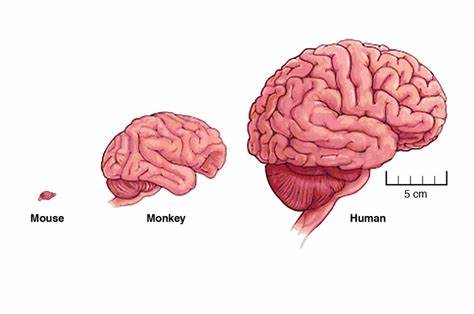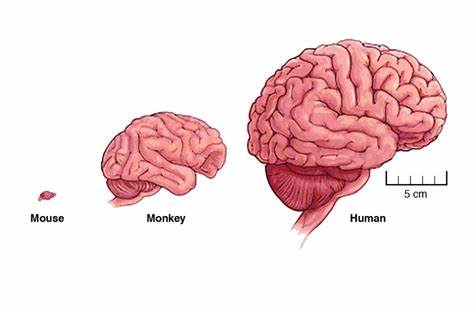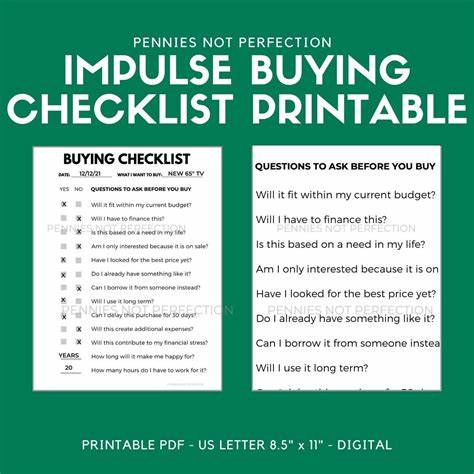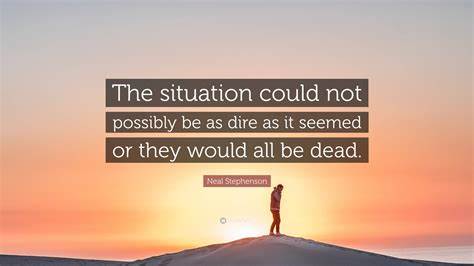Radiometrie ist ein grundlegendes Konzept für das physikalisch basierte Rendern und bildet die Basis für eine realistische Darstellung von Licht in computergenerierten Szenen. Doch trotz ihrer Wichtigkeit ist Radiometrie für viele Grafikprogrammierer und Künstler eine Herausforderung, vor allem aufgrund der traditionellen Herangehensweise, die meist bei der Strahlungsenergie beginnt. Die meisten Lehrbücher und Vorlesungen erklären radiometrische Größen beginnend mit der Strahlungsenergie – einer physikalisch greifbaren Größe, die sich aus der Anzahl der Photonen und deren Energie zusammensetzt. Jedoch ist dieser Startpunkt im Bezug auf die Anwendung auf moderne Renderer wie Pfad-Tracer oft wenig intuitiv und führt leicht zu Missverständnissen. Ein anderer Weg, der Radiance in den Mittelpunkt stellt und von dort aus die anderen Größen herleitet, bietet eine klarere und praxisorientiertere Sicht auf das Problem.
Besonders für Entwickler von Renderern ist das Verständnis von Radiance essenziell, denn letztlich ist es diese Größe, deren Kenntnis es erlaubt, das Verhalten von Licht in einer Szene präzise zu modellieren und zu berechnen. Radiance – der Kern nahezu aller Lichtberechnungen Radiance ist eine radiometrische Größe, die ausdrückt, wie viel Licht in eine bestimmte Richtung von einem bestimmten Punkt im Raum ausgestrahlt wird. In der Sprache der Physik misst Radiance die Strahlungsleistung pro Flächeneinheit und pro Raumwinkeleinheit, formal in Watt pro Quadratmeter und Steradiant (W/m²·sr) angegeben. Für Renderer und Kamerasimulationen ist Radiance besonders relevant, weil es sich entlang einer Geraden unverändert ausbreitet – vorausgesetzt, das Licht durchläuft ein Vakuum oder ein homogenes Medium ohne Absorption oder Streuung. Dieses Verhalten macht Radiance zur idealen Größe, um Lichtstrahlen zu verfolgen, was das Herzstück von Raytracing-Methoden ist.
Eine Kamera misst trotz ihrer technischen Limitierungen eine Größe, die zumindest proportional zur Radiance ist. Die Pixel eines Bildsensors erfassen Photonen, also Strahlungsenergie über eine kleine Fläche und innerhalb einer Zeitspanne. Indem dieser Messvorgang auf immer kleinere Bereiche und kürzere Zeitintervalle reduziert wird, nähert sich das Ergebnis der Radiance an. Diese Vorstellung ermöglicht ein tieferes Verständnis dafür, warum Renderer häufig direkt mit Radiance arbeiten, ohne sich zunächst mit komplizierteren Ableitungen von Strahlungsenergie zu beschäftigen. Grenzen traditioneller Darstellungen der Radiometrie Konventionelle Darstellungen beginnen oft mit Strahlungsenergie, einer für die reale Welt greifbaren Größe, und definieren dann Beispiele wie Strahlungsfluss (Radiant Flux), Bestrahlungsstärke (Irradiance) und schließlich Radiance – meist unter Verwendung von Grenzwertprozessen und Differentialquotienten.
Solche Ableitungen haben ihren Vorteil in der physikalischen Strenge, sie sind aber für Einsteiger häufig schwer verständlich. Der Schritt von der Energie hin zu Fluss und weiter zu Radiance basiert auf der Betrachtung winziger Flächenelemente und der Menge an Energie, die durch oder auf diese Elemente trifft, wenn diese Flächen gegen Null gehen. Dabei spielen Aspekte wie die Orientierung der Fläche und die Verteilung der Lichtstrahlen eine zentrale Rolle. Die mathematische Notation und das Konzept von Ableitungen, die in diesem Kontext verwendet werden, unterscheiden sich jedoch von derjenigen aus Schulmathematik und erscheinen deshalb abstrakt. Zudem bleiben wichtige physikalische Eigenschaften, wie die Ausrichtung von Oberflächen oder die räumliche Verteilung von Licht, oft im Verborgenen.
Gerade in der Praxis der Computergrafik braucht man jedoch intuitive und gut handhabbare Erklärungen. Daher ergibt sich eine Notwendigkeit für alternative Zugänge, die stärker auf Integralen basieren und Radiance als Ausgangspunkt verwenden. Solidwinkel: Der Schlüssel zum Verstehen von Richtungsmaßen Um Radiance richtig zu interpretieren, ist es wichtig, die Einheit Steradiant zu verstehen, die den sogenannten Solidwinkel misst. Während der normale Winkel ein Maß für die räumliche Ausdehnung in einer Ebene beschreibt und in Radianten angegeben wird, misst ein Solidwinkel die Ausdehnung eines Bereichs von Richtungen im dreidimensionalen Raum – also auf der Einheitssphäre. Jede Richtung lässt sich als Einheitsvektor auf dieser Kugeloberfläche darstellen.
Der Solidwinkel beschreibt die Fläche, die eine Lichtquelle oder ein Objekt auf dieser Einheitssphäre einnimmt. Stellen wir uns vor, wir betrachten einen Würfel von einem Punkt im Raum. Die Menge aller Richtungvektoren zu den Würfelseiten bilden einen Teilbereich der Einheitssphäre. Die Fläche dieses Bereichs entspricht dem Solidwinkel, den der Würfel aus diesem Blickwinkel einnimmt. Der gesamte Solidwinkel der Einheitssphäre beträgt 4π Steradiant, wobei eine Halbkugel entsprechend 2π Steradiant misst.
Dieses Verständnis ist grundlegend, weil Radiance immer bezogen auf diesen Solidwinkel angegeben wird und zeigt, wie viel Leistung pro Flächeneinheit und pro Raumwinkeleinheit abgegeben wird. Irradiance: Wie viel Licht trifft auf eine Oberfläche? Radiance ist zwar die wichtigste Größe, wenn es um das Berechnen von Lichtstrahlen geht, doch oft möchte man wissen, wie viel Licht eine ganze Oberfläche „erhält“. Hier kommt der Begriff der Bestrahlungsstärke (Irradiance) ins Spiel. Um Irradiance für einen Punkt und eine Oberfläche mit einer gegebenen Orientierung zu definieren, wird Radiance über alle Richtungen integriert. Allerdings muss dabei berücksichtigt werden, dass Licht, das von schrägen Winkeln auf die Oberfläche trifft, sich über eine größere Fläche verteilt als das direkt von oben einfallende Licht.
Dieser Effekt wird über das Skalarprodukt zwischen dem Oberflächennormalvektor und der Einfallsrichtung des Lichtstrahls beschrieben – der Cosinus des Winkels zwischen diesen Vektoren. Weil Radiance in W/m²·sr gemessen wird, und wir über einen Solidwinkel (in sr) integrieren, kürzt sich die Einheit Steradiant heraus, sodass Bestrahlungsstärke in Watt pro Quadratmeter (W/m²) angegeben wird. Irradiance beschreibt unmittelbar, wie stark eine Fläche beleuchtet wird – und ist somit die relevante Größe für alle Oberflächenreaktionen auf Licht, wie zum Beispiel das Streuen oder Absorbieren. Radiant Flux: Das Licht über die ganze Fläche Wird über die gesamte Fläche eines Objekts integriert, erhält man den sogenannten Strahlungsfluss (Radiant Flux). Er gibt die gesamte Lichtleistung an, die an der Oberfläche ankommt oder von ihr abgegeben wird.
Die Einheit ist einfach Watt (W), weil die Flächenkomponente der Einheiten bereits integriert wurde. Für Renderer und Lichtquellen ist dieser Wert besonders wichtig, wenn es darum geht, die Helligkeit einer Lichtquelle unabhängig von deren Größe zu spezifizieren. So kann ein Flächenlicht beliebig vergrößert werden, ohne dass sich der Gesamteindruck der ausgestrahlten Energiemenge ändert, wenn man den Strahlungsfluss konstant hält. Radiant Energy: Die physikalische Größe der Lichtmenge Schließlich lässt sich aus dem Strahlungsfluss unter Einbezug der Zeit die Strahlungsenergie ableiten. Wird der Fluss über ein Zeitintervall integriert, erhält man die Gesamtenergie, die in dieser Zeitspanne auf eine Oberfläche trifft oder von dieser abgegeben wird.
Diese Größe ist besonders physikalisch greifbar, da sie direkt mit der Anzahl der Photonen verknüpft ist und somit auch die Grundlage für sensorische Messungen wie Kameraexpositionen darstellt. Ein Blick auf Intensität Zusätzlich zur klassischen Ableitung gibt es in der Radiometrie eine analytische Größe namens Intensität, die den Strahlungsfluss pro Raumwinkeleinheit beschreibt, jedoch über eine Fläche (meist eine Lichtquelle) integriert wird. Die Intensität ist also eine Richtungsverteilung der Strahlungsleistung einer Lichtquelle und wird in Watt pro Steradiant (W/sr) angegeben. Diese Größe ist die Grundlage von IES-Profilen, welche bei der Beschreibung von Designleuchten und deren Leuchtrichtungscharakteristiken zum Einsatz kommen. Die Bedeutung für das physikalisch basierte Rendern Das Verständnis dieser radiometrischen Größen ist nicht nur theoretisch interessant, sondern praktisch unerlässlich für das Erstellen hochwertiger, realistischer Renderbilder.
Gerade mit der Entwicklung von Echtzeit-Raytracing-Technologien wird der Bedarf nach präziser Lichtsimulation immer größer. Ein Mangel an Radiometrie-Wissen kann zu Fehlern in der Berechnung führen, etwa durch falsches Multiplizieren mit Kosinus-Terms oder nicht-passendem Umgang mit Flächen- und Richtungsmaßen. Während frühere Echtzeitmethoden oft ohne tiefgreifendes Radiometriewissen auskamen, etwa durch vereinfachte Point-Light-Modelle, erfordert die pfadbasierte Lichtsimulation ein exaktes mathematisches Fundament. Das gilt insbesondere bei komplexen Sampling-Strategien, Monte-Carlo-Integration und der Simulation von Interaktion zwischen Licht und Materie. Ein zentrales Konzept dabei ist, dass Pfad-Tracer primär Radiance entlang von Lichtstrahlen berechnen und aggregieren, statt direkt mit Strahlungsenergie zu hantieren.
Fazit: Radiance als Ausgangspunkt für Radiometrie Die traditionelle Einführung in die Radiometrie über Strahlungsenergie und Differentialquotienten kann manchem Lerner mehr Verwirrung als Erkenntnis bringen. Indem man jedoch Radiance ins Zentrum stellt und alle anderen Größen als Integrale über Radiance begreift, gewinnt man ein intuitiveres Verständnis, das unmittelbar mit dem Vorgehen in modernen Renderern verbunden ist. Radiance beschreibt das Licht entlang von Strahlen, bleibt entlang von Freiangswegen unverändert und bildet die Grundlage für die Lichttransportgleichungen, die Computergraphik überhaupt erst realistisch möglich machen. Dieser integrale Zugang hilft nicht nur beim Lernen, sondern auch bei der praktischen Implementation. Entwickler von Renderern können direkt mit Radiance arbeiten, Radiometric Quantities berechnen und verstehen, warum Kosinus-Weightings in Integralen notwendig sind, um korrekte Beleuchtungen realisieren zu können.
So getragen von einem fundierten radiometrischen Verständnis, lässt sich Rendering nicht mehr als eine bloße Kunst, sondern als eine naturwissenschaftlich fundierte Technik meistern.
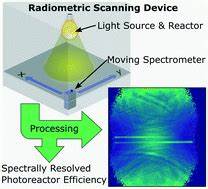


![Standardization limits the highest performers [video]](/images/735D724C-60D9-4D46-8BB5-3471FB4EDD27)