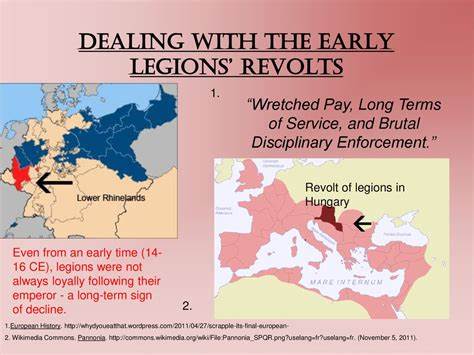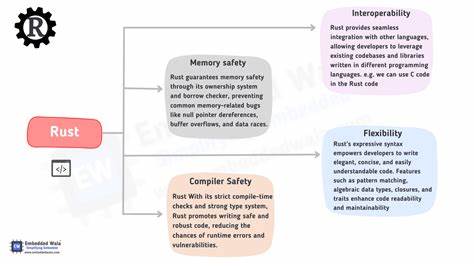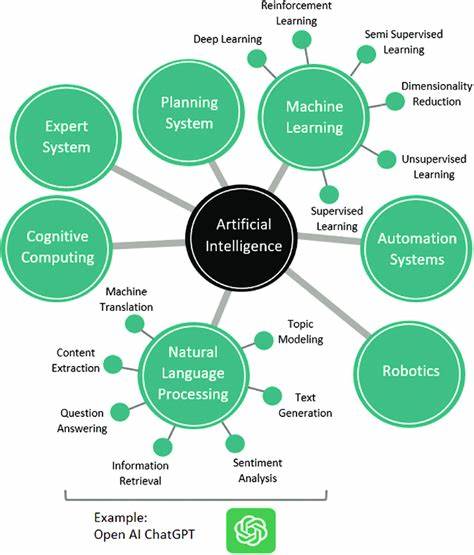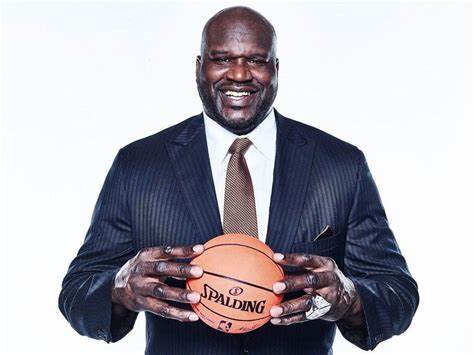In München manifestieren sich zunehmend erste Anzeichen eines politischen und technologischen Aufbegehrens gegen die bisher vorherrschende Dominanz amerikanischer Hyperscaler im europäischen Digitalmarkt. Die Diskussionen, die seit einiger Zeit in den Führungsetagen Europas und insbesondere im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz sowie beim Nextcloud Summit geführt werden, verdeutlichen die wachsende Bedeutung von digitaler Souveränität. Diese Dynamik ist Ausdruck eines tieferliegenden Strebens nach technologischer Autonomie und einer Abkehr von der bisherigen Abhängigkeit von US-Technologiegiganten wie Google, Microsoft und Amazon. Der Begriff der digitalen Souveränität beschreibt die Fähigkeit eines Staates oder einer Staatengemeinschaft, die Kontrolle über die digitale Infrastruktur, Daten und Technologien innerhalb ihrer Rechtsordnung zu behalten. Lange Zeit dominierten vor allem amerikanische Unternehmen den Markt für Cloud-Dienste, digitale Infrastruktur und Software-Lösungen in Europa.
Dies führte zu einer weitreichenden technischen Abhängigkeit, die inzwischen als Risiko für die wirtschaftliche Stabilität, nationale Sicherheit und politische Unabhängigkeit Europas erkannt wird. Die politische Brisanz dieser Abhängigkeit wurde durch verschiedene Ereignisse noch verstärkt. Insbesondere die jüngsten politischen Spannungen zwischen den USA und der Europäischen Union verschärfen die Situation. Die US-Regierung unter der Trump-Administration verschärfte mit ihrer anhaltenden Kritik an der europäischen Regulierungspolitik und Androhungen von Strafzöllen auf europäische Produkte auch die geopolitischen Spannungen. Im Februar 2025 sorgte der US-Vizepräsident JD Vance mit seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz für großes Aufsehen.
Er kritisierte die europäische Führung offen und warf ihr vor, die demokratischen Werte nur unzureichend zu wahren. Diese Äußerungen stießen in Europa auf scharfe Ablehnung und heizten die Debatte um technologische Unabhängigkeit zusätzlich an. Neben politischen Aspekten spielen auch juristische Rahmenbedingungen eine entscheidende Rolle. Das US Cloud Act zwingt amerikanische Unternehmen dazu, Daten auch dann herauszugeben, wenn sie innerhalb Europas gespeichert sind, sofern US-Behörden dies verlangen. Diese Regelung stellt für europäische Unternehmen und öffentliche Institutionen ein erhebliches Risiko dar, wenn vertrauliche oder sensible Daten dadurch in fremde Hände geraten könnten.
Vor diesem Hintergrund wächst in Europa der Ruf nach einem eigenen technologischen Ökosystem, das nicht länger von den multinationalen Hyperscalern kontrolliert wird. Politiker, Branchenexperten und Technologen arbeiten zusammen an diesem Ziel und versuchen, alternative digitale Plattformen und Infrastrukturen zu etablieren. Beispiele dafür sind Initiativen wie Gaia-X, die auf eine europäische Cloud-Infrastruktur abzielen. Allerdings werden diese Bemühungen oft durch starken Lobbyismus der großen Tech-Giganten erschwert. Experten wie die deutsche Europaabgeordnete Alexandra Geese und die Ökonomin Cristina Caffara warnen davor, dass Hyperscaler mit einer „Armee von Lobbyisten“ versuchen, digitale Souveränitätsprojekte zu sabotieren oder zu verwässern.
Muntere Diskussionen auf Konferenzen wie dem Nextcloud Summit zeigen den Willen Europas, trotz aller Zwänge und Herausforderungen eine eigene Infrastruktur aufzubauen. Nextcloud selbst ist ein Beispiel für solche Bemühungen: Mit Open-Source-Lösungen für sichere und selbst gehostete Kollaborationssoftware beweist das Unternehmen, dass Unabhängigkeit machbar ist. Dabei geht es nicht darum, Europa abzuschotten, sondern offene Standards zu fördern und gleichzeitig die Kontrolle über sensible Daten und digitale Dienstleistungen zu behalten. Die Herausforderung besteht aber darin, dass die Technologielandschaft global stark verflochten ist. Viele wichtige Bauteile und Softwarekomponenten stammen aus den USA oder aus anderen Teilen der Welt, etwa China.
Chinesische Technologieunternehmen bieten zwar Alternativen, doch auch diese gelten in Europa aufgrund geopolitischer Spannungen und Sicherheitsbedenken als ambivalente Partner. Ein vielversprechendes Zeichen für die europäische technologische Zukunft ist der Bau eines der größten Halbleiterfabriken Europas durch ein Joint Venture aus deutschen und internationalen Firmen. Eine Investition in Höhe von zehn Milliarden Euro soll die Abhängigkeit von ausländischen Chip-Herstellern verringern und Europa eine solide Grundlage für eigene Innovationen schaffen. Dennoch sind die US-Konzerne weiterhin stark präsent. So wurde beispielsweise bekannt, dass die Bundeswehr Cloud-Dienste von Google nutzt, was bei vielen Fachleuten für Besorgnis sorgt.
Die Gefahr, dass Dienste aus politischen Gründen eingeschränkt oder gar blockiert werden könnten, wird als real gesehen. Die Politik sieht sich somit gezwungen, sowohl strategische Entscheidungen zu treffen als auch kurzfristige Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Europa befindet sich also an einem Scheideweg. Die zunehmenden Spannungen im transatlantischen Verhältnis und die schwindende Verlässlichkeit in der Zusammenarbeit mit US-Unternehmen fördern die Entwicklung von digitalen Alternativen und einer europäischen Technologiepolitik, die stärker auf Unabhängigkeit und Sicherheit setzt. Gleichzeitig sind die Herausforderungen enorm.
Es bedarf nicht nur finanzieller Investitionen, sondern auch eines langfristigen politischen Willens und einer Bündelung von Kompetenzen aus Wirtschaft, Forschung und Verwaltung. Ein erhebliches Hindernis ist die Lobbyarbeit der großen Technologieunternehmen. Diese versuchen, Initiativen zu verwässern, bürokratisch zu überfrachten oder durch Einflussnahme auf politische Entscheidungsträger zu verhindern, dass Europa handlungsfähige Lösungen entwickelt. Die Auseinandersetzung um die digitale Souveränität ist somit auch ein Kampf um die Zukunft der europäischen Wettbewerbsfähigkeit im digitalen Zeitalter. Während Europa Schritte zu gehen beginnt, verfolgt Großbritannien eine andere Strategie.
Die britische Regierung plant, sich als „KI-Supermacht“ zu positionieren und setzt dabei auf enge Zusammenarbeit mit US-amerikanischen Technologieanbietern. Dies zeigt sich an der Einladung großer Tech-Konzerne wie Oracle, AWS, Google und Microsoft, massiv in Datacenter-Infrastruktur und KI-Forschung auf britischem Boden zu investieren. Der Technologie-Minister Peter Kyle traf sich in kurzer Zeit deutlich häufiger mit Vertretern amerikanischer Firmen als sein Vorgänger und sorgt damit ebenfalls für Diskussionen bezüglich der Abhängigkeit von US-Technologie. Der UK Premierminister Keir Starmer betont zwar den Wunsch nach Unabhängigkeit von großen Mächten wie den USA, China oder der EU, doch das große Engagement amerikanischer Unternehmen deutet darauf hin, dass Großbritannien zumindest vorerst auf bewährte Partnerschaften setzt. Die jüngst angekündigte Gründung eines Forums für souveräne KI-Infrastruktur unter Führung des CEOs von Nvidia unterstreicht diese Tendenz.
Nichtsdestotrotz lässt sich auch in Großbritannien ein gewisses Bewusstsein für digitale Souveränität erkennen – wenn auch mit einem anderen Fokus und unter anderen Voraussetzungen als in der EU. Für den europäischen Kontinent bleibt die Herausforderung, eine echte technologische Autonomie aufzubauen, dringlicher denn je. Auf dem Münchner Nextcloud Summit und anderen Veranstaltungen wird deutlich, dass die digitale Souveränität nicht nur ein technisches, sondern auch ein gesellschaftliches Thema ist. Die Kontrolle über Daten, die Unabhängigkeit von ausländischen Anbietern und der Erhalt von digitalem Know-how in Europa sind essenziell, um die Wertefreiheit und die Sicherheit der Gesellschaft zu gewährleisten. Neben der Regulierung und dem Auf- und Ausbau eigener Infrastruktur spielt die Förderung europäischer Unternehmen eine zentrale Rolle.
Talente sollen gehalten werden, Innovationen gefördert und ein offener Austausch unter Beteiligten gewährleistet werden. Offene Standards sind dabei ein Schlüssel, um Kooperationen innerhalb Europas und darüber hinaus zu ermöglichen, ohne die digitale Unabhängigkeit zu gefährden. Insgesamt steht Europa am Beginn eines herausfordernden, aber notwendigen Prozesses. Es geht darum, weniger anfällig für politische Einflüsse von außen zu sein, die Kontrolle über kritische digitale Infrastruktur zurückzugewinnen und eine wettbewerbsfähige digitale Wirtschaft zu schaffen, die auf Souveränität, Sicherheit und Innovation basiert. Die „Revolte“ gegen die Hyperscaler ist somit nicht nur ein Kampf gegen unfaire Marktpraktiken, sondern vor allem ein Signal für den Wandel in den Grundfesten der europäischen Digitalpolitik.
Der Weg dorthin wird langwierig und komplex sein. Doch gerade in München werden die Weichen gestellt – für ein Europa, das seine digitale Zukunft in eigener Hand hält.