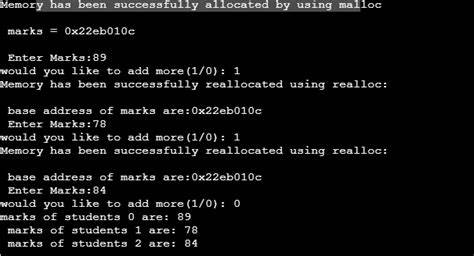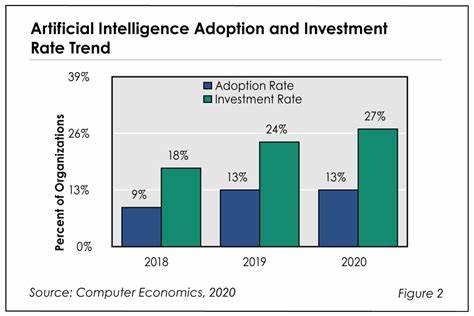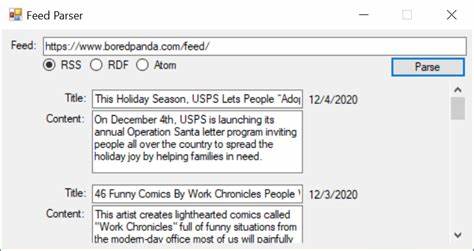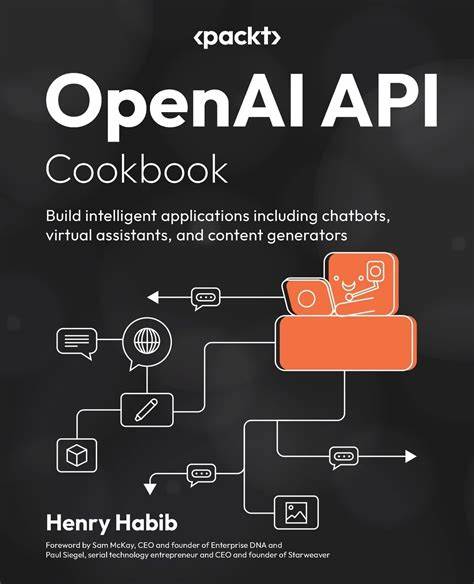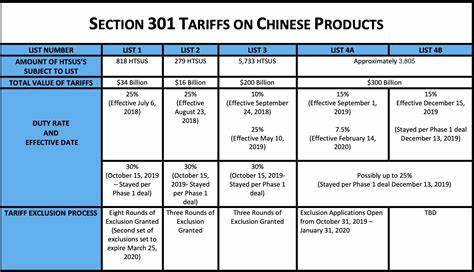In den letzten Jahren hat sich das Verhältnis zwischen China und den Vereinigten Staaten enorm verschärft. Die Spannungen reichen von Handelskonflikten über technologische Rivalitäten bis hin zu geopolitischen Machtspielen im asiatisch-pazifischen Raum. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass Chinas Staatschef Xi Jinping in einer bemerkenswerten Rede die US-Hegemonie mit faschistischen Kräften verglichen hat. Diese Aussage wirft nicht nur Schlaglichter auf die gegenwärtige Weltordnung, sondern verdeutlicht auch die verschärfte Rhetorik in den internationalen Beziehungen. Xi Jinpings Vergleich ist keineswegs eine beiläufige Bemerkung.
Er wurde in einer Zeit geäußert, in der die Beziehungen zwischen den beiden größten Wirtschaftsmächten der Welt zunehmend angespannt sind. Der chinesische Präsident spielte dabei auf eine lange Geschichte des westlichen Einflusses und der amerikanischen Dominanz in globalen Angelegenheiten an, die aus seiner Sicht einer „Hegemonie“ gleichkommt, die mit Unterdrückung, Machtmissbrauch und aggressiven Eingriffen in die Souveränität anderer Nationen verbunden ist. Der Begriff „faschistische Kräfte“ hat starke historische Konnotationen, die auf totalitäre Regime, die durch diktatorische Führung, Unterdrückung politischer Andersdenkender und expansive Kriegspolitik gekennzeichnet sind, zurückgehen. Indem Xi Jinping die US-Hegemonie mit dieser Ideologie vergleicht, stellt er die USA als eine kraftvolle Kräfte dar, die nicht nur ihre Macht ausnutzen, sondern auch eine Bedrohung für den Weltfrieden und die internationale Ordnung darstellen. Diese rhetorische Strategie dient mehreren Zwecken.
Zum einen signalisiert China damit seine Ablehnung der bisherigen globalen Ordnung, in der die USA eine dominante Rolle spielen. Zum anderen stärkt sie die innenpolitische Position von Xi Jinping, indem sie einen klaren Gegner benennt und das Bild eines starken Führers fördert, der gegen externe Bedrohungen die Interessen Chinas verteidigt. Hinzu kommt, dass diese Aussage vor einem geplanten Gipfeltreffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen wurde, was verdeutlicht, wie sehr Russland und China versuchen, eine gemeinsame Front gegen die USA zu bilden. International hat diese Äußerung gemischte Reaktionen hervorgerufen. Während westliche Staaten meist von „provokanter Sprache“ sprechen und die Vorwürfe als unbegründet zurückweisen, finden in anderen Teilen der Welt, besonders in Ländern, die sich von westlicher Einflussnahme gestört fühlen, die Worte Xi Jinpings durchaus Resonanz.
Viele asiatische, afrikanische oder lateinamerikanische Staaten sehen in den amerikanischen Interventionen eine Form der Neo-Kolonisierung und erkennen sich in der Kritik wieder. Die Geschichte der US-Hegemonie ist komplex und wird von verschiedenen Perspektiven unterschiedlich bewertet. Die USA spielten seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine zentrale Rolle in der Gestaltung der internationalen Ordnung – durch multilaterale Institutionen wie die Vereinten Nationen, die Weltbank oder die NATO. Zugleich haben wirtschaftliche, militärische und politische Eingriffe in souveräne Staaten, wie zum Beispiel in Irak, Libyen oder Syrien, immer wieder starke Kritik hervorgerufen. Aus chinesischer Sicht verfolgt Washington häufig eine Politik, die darauf abzielt, den Aufstieg Chinas einzudämmen.
Handelskriege, Sanktionen, Zusammenarbeit mit Verbündeten im Rahmen von Sicherheitsbündnissen und die militärische Präsenz im Südchinesischen Meer sind Beispiele für diese Strategie. Xi Jinpings harsche Worte spiegeln also auch den Unmut über das, was China als Versuche der Eindämmung seiner wachsenden globalen Macht betrachtet. Doch die Verwendung des Faschismusvorwurfs ist nicht nur eine politische Kalkulation, sondern auch eine kulturelle Botschaft. Faschismus ist ein in China stark negativ konnotierter Begriff, der für Unterdrückung, Krieg und Wahnsinn steht. Durch dieses Bild will Xi nicht nur ein falsches Bild der USA konstruieren, sondern zugleich die moralische Überlegenheit Chinas unterstreichen.
China präsentiert sich in diesem Narrativ als Verfechter von Frieden, Stabilität und einer multipolaren Weltordnung, die auf Gleichberechtigung der Staaten basiert. Die Auswirkungen dieser Rhetorik auf die internationalen Beziehungen sind vielfältig. Zum einen verschärfen sich die Spannungen zwischen den Großmächten weiter, was die Gefahr von Missverständnissen und Konflikten erhöht. Zum anderen könnte die Verschiebung der globalen Machtkonstellationen langfristig zu einer Neuordnung der internationalen Institutionen führen, in denen China und seine Partner einen größeren Einfluss anstreben. Europäische Länder beobachten diese Entwicklungen mit Sorge, weil sie zwischen den beiden Supermächten eine Balance halten wollen.
Viele Staaten sind wirtschaftlich und sicherheitspolitisch eng mit den USA verbunden, sehen aber zugleich wachsendes Potenzial in Kooperationen mit China. Die polarisierende Sprache erschwert die diplomatischen Bemühungen, Brücken zu bauen und eine konstruktive Zusammenarbeit zu fördern. Für die chinesische Gesellschaft selbst hat die Kritik an den USA auch eine innenpolitische Komponente. In Zeiten wirtschaftlicher Herausforderungen und sozialer Veränderungen stärkt die Betonung eines äußeren Feindes den Zusammenhalt und legitmiert die Politik der Kommunistischen Partei. Die Darstellung der USA als Aggressor und Unterdrücker dient dazu, nationale Einheit zu fördern und von internen Problemen abzulenken.
Nicht zuletzt steht der Vergleich von Xi Jinping auch im Kontext eines weltweiten Kampfes um Werte und Ideologien. Während die USA oft ihre Demokratiemissionen und das Bekenntnis zu Menschenrechten herausstellen, betont China zunehmend die Souveränität der Staaten, Nicht-Einmischung und Entwicklungsmodelle jenseits des westlichen Liberalismus. Diese Gegensätze spiegeln sich in der Schärfe der politischen Debatten und auch in den wirtschaftlichen und militärischen Rivalitäten wider. Die Äußerungen von Xi Jinping sind damit nicht nur symbolisch, sondern Teil einer umfassenden Strategie, die darauf abzielt, Chinas globale Stellung auszubauen und die bestehende US-Dominanz in Frage zu stellen. In einer multipolaren Weltordnung könnten solche Botschaften zu neuen Allianzen und Partnerschaften führen, aber auch die Risiken von geopolitischen Spannungen erhöhen.
Zukünftig dürfte die internationale Gemeinschaft im Umgang mit China auf diplomatische Geschicklichkeit setzen müssen, um eine Eskalation zu vermeiden. Dabei wird es entscheidend sein, die legitimen Interessen aller Seiten zu berücksichtigen und Wege der Kooperation zu suchen, die Sicherheit, Wohlstand und Frieden fördern. Der Vergleich der US-Hegemonie mit faschistischen Kräften durch Xi Jinping ist somit ein deutliches Signal für die Verschiebung globaler Machtverhältnisse und eine Herausforderung für die bestehende internationale Ordnung. Er verdeutlicht die tiefgreifenden ideologischen Differenzen und die unterschiedlichen Vorstellungen von globaler Führung, die die Weltpolitik in den kommenden Jahren prägen werden.