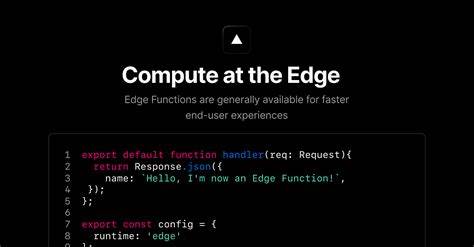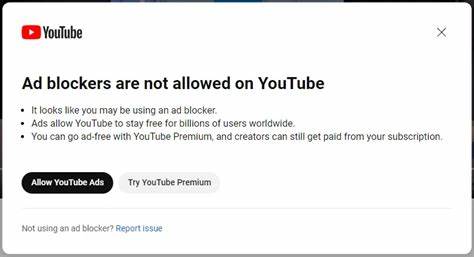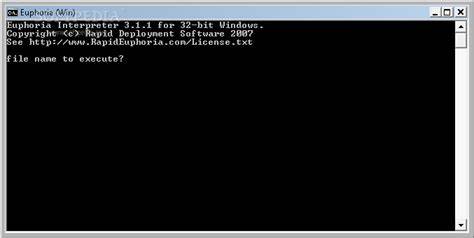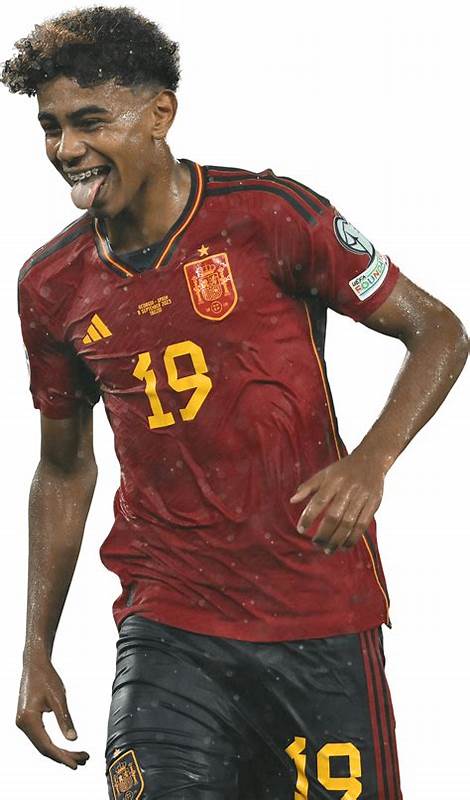Die rasante Entwicklung der Computertechnologie und der künstlichen Intelligenz hat die Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten maßgeblich verändert. Trotz dieser Fortschritte gibt es immer noch fundamentale Grenzen dessen, was Computer leisten können. Hubert Dreyfus, ein renommierter Philosoph und Kritiker der frühen KI-Forschung, hat in seinem Werk „What Computers Still Can't Do“ grundlegende Einwände gegen die damaligen Optimismen in der KI-Forschung formuliert, die auch heute noch von großer Bedeutung sind. Seine Kritik hinterfragt die tief verwurzelten Annahmen der künstlichen Intelligenz und bietet wertvolle Einsichten in die Herausforderungen, vor denen das Gebiet steht. Dreyfus beginnt mit einer historischen Analyse der KI-Forschung zwischen 1957 und 1967, einer Zeit, in der viele Forscher vom grenzenlosen Potential künstlicher Intelligenz überzeugt waren.
Diese optimistische Sichtweise basierte auf einer Reihe von Annahmen, die Dreyfus als biologisch, psychologisch, epistemologisch und ontologisch bezeichnet. Diese Annahmen gingen davon aus, dass menschliches Denken und Verhalten formalisiert und algorithmisch dargestellt werden könnten, was Computer im Prinzip reproduzieren könnten. Das erste davon, die biologische Annahme, unterstellt, dass das Gehirn ähnlich wie ein Computer funktioniert und dass das Denken letztendlich auf mechanischen Prozessen basiert. Dreyfus widerspricht dieser Sichtweise, indem er argumentiert, dass das menschliche Gehirn nicht einfach mit einer Maschine vergleichbar ist, da menschliche Intelligenz auch stark von Kontext, Erfahrung und einem unbewussten Verständnishorizont abhängig ist. Computersysteme, so Dreyfus, können formale Regeln befolgen, aber sie fehlt ihnen an echtem, intuitivem Verständnis, wie es der Mensch besitzt.
In Verbindung damit steht die psychologische Annahme, die davon ausgeht, dass menschliche Denkprozesse symbolisch und regelbasiert sind. Dreyfus stellt dies infrage, indem er betont, dass menschliches Verhalten oft unbewusst und situationsabhängig ist. Viele unserer Entscheidungen basieren nicht auf expliziten Regeln, sondern auf einem impliziten, verkörperten Wissen, das sich nicht einfach in Algorithmen übersetzen lässt. Dieses implizite Wissen ist schwer zu fassen, weil es komplex, dynamisch und kontextgebunden ist. Die epistemologische Annahme beinhaltet die Idee, dass Wissen in Form von explizitem, symbolischem Wissen dargestellt werden kann.
Für viele KI-Systeme blieb diese Annahme zentral, weshalb viel Aufwand darauf verwendet wurde, Wissen in Wissensbasen zu kodieren. Dreyfus macht deutlich, dass menschliches Wissen viel tiefer und gestaltender ist als nur bloße Fakten und Regeln. Intuitive Urteile, Erfahrungen und Kontext spielen eine entscheidende Rolle beim Wissenserwerb und bei der Anwendung von Wissen in der Welt. Schließlich betrachtet Dreyfus die ontologische Annahme, welche davon ausgeht, dass die Welt so beschaffen ist, dass sie vollständig durch formale Systeme beschrieben werden kann. Dies ist ein zentraler Punkt, da viele KI-Modelle auf der Idee basieren, dass die Welt logisch und symbolisch dargestellt werden kann.
Dreyfus zeigt auf, dass die Welt häufig unscharf, mehrdeutig und dynamisch ist, was eine vollständige formale Repräsentation verunmöglicht. Dreyfus kritisiert, dass die frühe KI-Forschung diese Annahmen zu optimistisch akzeptierte, was zu einer Überschätzung der Fähigkeiten der Computer führte. Er hebt hervor, dass der Versuch, menschliches Denken ausschließlich durch logische formale Systeme abzubilden, scheitert, weil die Voraussetzung nicht vollständig stimmt. Darüber hinaus beschäftigt sich Dreyfus mit alternativen Ansätzen, die einen besseren Umgang mit der Komplexität der menschlichen Intelligenz ermöglichen sollen. Er plädiert für eine Betrachtung des Menschen als verkörpertes Wesen („embodied being“) mit einem tief verwurzelten Kontextbewusstsein, das in der körperlichen Erfahrung und der Umwelt eingebettet ist.
Diese Sichtweise führt zu der Erkenntnis, dass Intelligenz nicht nur aus abstrakten Rechenprozessen besteht, sondern auch aus der Fähigkeit, mit der konkreten Welt zu interagieren und diese Erfahrung in Entscheidungsprozesse einfließen zu lassen. Sein Begriff des „situativen Verstehens“ verweist darauf, dass menschliches Wissen immer in einem Kontext eingebettet und an die jeweilige Situation angepasst ist. Dieses Wissen ist flexibel und nicht vollständig algorithmisierbar. Deshalb sind viele Aufgaben, die für Menschen trivial sind – etwa das Erkennen von Gesten, das Verstehen von Sprache oder das Navigieren in komplexen sozialen Situationen – für Computer extrem schwer zu bewältigen. In seinem Fazit umreißt Dreyfus die Grenzen künstlicher Intelligenz klar: Maschinen können bestimmte Aufgaben, die klar definierte Regeln und Daten erfordern, hervorragend erledigen.
Doch wenn es darum geht, kreatives Denken, intuitives Verstehen und flexible Anpassung an komplexe, dynamische Situationen zu leisten, stoßen Computer an ihre Grenzen. Seine Arbeit legt nahe, dass künstliche Intelligenz nie eine vollwertige Nachahmung menschlicher Intelligenz erreichen wird, solange diese fundamentalen Unterschiede ignoriert werden. Auch heute, Jahrzehnte nach Dreyfus’ Kritik, behalten seine Einsichten ihre Relevanz. Während moderne KI-Systeme enorme Fortschritte gemacht haben, insbesondere im Bereich maschinellen Lernens und der Verarbeitung natürlicher Sprache, sind die fundamentalen Herausforderungen, die Dreyfus benannt hat, weiterhin spürbar. Die gängigen KI-Modelle basieren nach wie vor weitgehend auf Daten, Algorithmen und statistischen Mustern, ohne das tiefere, situative und verkörperte Wissen zu erfassen, das menschliches Denken ausmacht.
Dreyfus’ Werk fordert uns auf, die Grenzen der KI realistisch einzuschätzen und nicht in einen blinden Optimismus zu verfallen, der technische und philosophische Herausforderungen ausblendet. Gleichzeitig zeigt seine Kritik, dass ein interdisziplinärer Ansatz notwendig ist, der Philosophie, Kognitionswissenschaft, Psychologie und Informatik verbindet, um die komplexen Facetten der Intelligenz besser zu verstehen. Die Frage, was Computer noch nicht können, ist nicht nur eine technische, sondern auch eine philosophische Frage. Sie berührt das Wesen menschlicher Erfahrung, Wissens und Vernunft. Dreyfus lädt dazu ein, über Technologie hinauszudenken und zu reflektieren, welche Eigenschaften den Menschen einzigartig machen und warum künstliche Intelligenz daran bislang nur begrenzt anknüpfen kann.
Diese Reflexion ist essentiell für die verantwortungsvolle Weiterentwicklung der KI und den Umgang mit ihren Möglichkeiten und Grenzen in der Zukunft.
![What Computers Still Can't Do – Hubert Dreyfus [pdf]](/images/FF53F4EE-1933-4492-BD21-31A061B83F86)