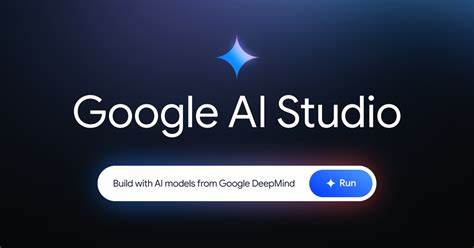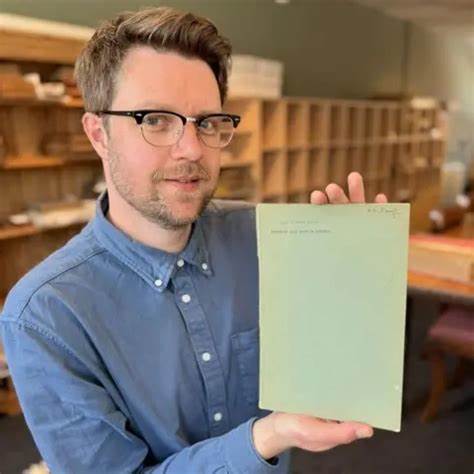Im August 2020 erschütterte ein verheerendes Feuer in einem Vorort von Denver, Colorado, eine gesamte Gemeinschaft. Dabei verloren fünf Menschen ihr Leben – darunter mehrere Mitglieder zweier Familien, die sich in einem Wohnhaus auf der 5312 Truckee Street aufgehalten hatten. Was zunächst wie ein tragischer Brand durch einen technischen Defekt erschien, entpuppte sich bald als brutale Tat. Drei Teenager aus nahegelegener Umgebung hatten das Feuer gelegt. Doch fast wären sie unentdeckt geblieben, wären da nicht ihre hinterlassenen digitalen Spuren gewesen – speziell ihre Google-Suchanfragen.
Die Geschichte beginnt mit Kevin Bui, einem 16-jährigen Jugendlichen aus einer wohlhabenderen Familie, der auf eine Verkettung persönlicher und sozialer Fehlentwicklungen reagierte. Nach einem Raub in Downtown Denver, bei dem er sein Handy und Geld verlor, schwor Bui Rache. Über mehrere Wochen hinweg recherchierte er die Adresse der Opferfamilien und plante zunächst Vandalismus. Spätere Nachrichten an seine Freunde deuteten jedoch auf eine Eskalation seiner Absichten hin: Zerstörung sollte nicht mehr genügen, die Tat sollte bewusstes Leid bringen. Zusammen mit seinen beiden Jugendlichen Freunden, Gavin Seymour und Dillon Siebert, machte er sich nachts auf, um den bedrohten Wohnsitz mit Benzin zu übergießen und anzuzünden.
Die Tat wurde gefilmt, doch die Maskierung der Täter erschwerte eine Identifikation. Die Ermittler, allen voran Detektiv Neil Baker vom Denver Police Department, kämpften zunächst mit einem Mangel an konkreten Spuren. Sie sicherten das Videomaterial von Überwachungskameras, untersuchten Handy-Daten und baten Mobilfunkanbieter um Hilfestellung. Weil das Gebiet und die Umstände verwirrend waren, mussten die Fahnder kreativ werden. Ein entscheidender Hinweis kam durch die Nutzung sogenannter Geofence-Warrants, durch die sich Bewegungsmuster von Mobiltelefonen im Tatzeitraum eingrenzen ließen.
Diese Daten führten zu einer Liste von Dutzenden verdächtigen Geräten, von denen sie die Anwohner ausschließen konnten. Doch der wahre Durchbruch gelang, als die Polizei einen wenig bekannten, aber umso folgenschwereren Ermittlungsansatz verfolgte: die Auswertung von Google-Suchanfragen. Mithilfe eines Reverse Keyword Search Warrants forderten die Ermittler von Google Daten über all jene Personen an, die in den Tagen vor dem Brand die Adresse des Wohnhauses in Suchmaschinen eingegeben hatten. Diese Maßnahme war rechtlich umstritten, da sie das private Suchverhalten von Millionen Nutzern betraf und potenziell in einem großen Maßstab private Daten durchforstete. Nach anfänglicher Ablehnung von Google gaben die Ermittler nicht auf und formulierten die Anfragen so präzise, dass sie akzeptiert wurden.
Die erhaltenen Daten lieferten Ergebnislisten mit IP-Adressen und Nutzerprofilen, die mit bereits vorhandenen Mobilfunkdaten abgeglichen werden konnten. Unter den wenigen Personen, die auffällig häufig und gezielt nach der Adresse suchten und sich zur Tatzeit auffällig verhielten, fanden sich Kevin Bui und seine beiden Komplizen wieder. Die Verhaftung der Jugendlichen führte zu umfangreichen Vernehmungen und weiteren Beweismitteln, die letztlich dazu führten, dass Kevin Bui seine Tat gestand. Trotz Unschuldsbeteuerungen seiner Freunde wurden alle drei strafrechtlich verfolgt, wobei Bui wegen der Führungsrolle und seiner Vorstrafen härter bestraft wurde. Die Gerichtsverhandlung dauerte mehrere Monate und entzündete vor allem wegen der Rechtmäßigkeit des Google-Suchdaten-Warrants eine intensive juristische Debatte.
Gegner solcher digitalen Dragnet-Ermittlungen bemängeln, dass das Sammeln und Auswerten von Suchanfragen ohne Verdachtsmomente gegen das Recht auf Privatsphäre und den Schutz vor ungerechtfertigten Durchsuchungen verstoße. Befürworter hingegen betonen, dass der Einsatz derartiger Mittel bei schweren Straftaten wie Mord essenziell sei und dass die Anfragen so eng gefasst werden müssten, dass nur ein minimaler Eingriff in die Privatsphäre der Nutzer erfolgt. Im Bundesstaat Colorado setzte der Fall schließlich einen Präzedenzfall. Der Oberste Gerichtshof entschied 2023, dass Reverse Keyword Suchanfragen grundsätzlich zulässig sind, sprach jedoch zugleich Einschränkungen bezüglich der Präzision und dem individuellen Verdachtsmoment aus. Die Entscheidung könnte weitreichende Folgen für zukünftige Ermittlungsverfahren haben, da sie eine Öffnung für den Einsatz digitaler Überwachungsmethoden signalisiert.
Der Fall zeigt exemplarisch, wie tief unser modernes Leben inzwischen mit digitalen Spuren verwoben ist und wie Suchmaschinen und Smartphones längst mehr als nur persönliche Hilfsmittel sind – sie können ebenso zu Beweismitteln werden. Die Frage, wo die Grenze zwischen Sicherheit und persönlicher Freiheit verläuft, wird derzeit in Anbetracht solcher Verfahren neu verhandelt. Trotz der langen juristischen Auseinandersetzungen und der veränderten Gesetzeslage bleibt die Geschichte der drei Teenager aus Lakewood eine tragische Warnung. Der Plan zur Rache endete in einem zerstörerischen Mord, der unzählige Leben zerstörte und viele Fragen über den Umgang mit digitalen Daten aufwarf. Die Ermittler betonen, wie wichtig es in Zeiten der Digitalisierung ist, über Hintergründe und Details von Technologien Bescheid zu wissen.