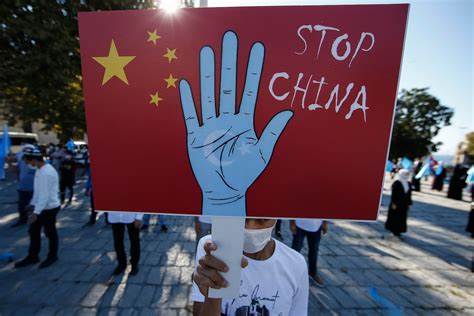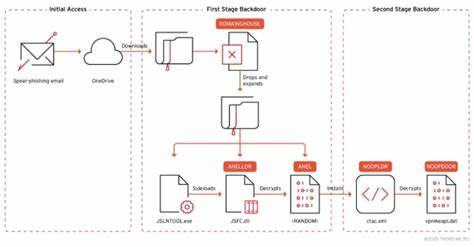Chinas jüngste Provokationen gegenüber dem Westen gehen weit über reine politische Schlagabtausche hinaus. Insbesondere im technologischen Bereich zeigt sich eine tiefgreifende Kluft in der Herangehensweise, die alle Facetten der geopolitischen und wirtschaftlichen Konkurrenz prägt. Während westliche Länder oftmals für kurzfristige Erfolge oder schnelle Innovationen bekannt sind, wirft China dem Westen heute vor, es mangele an strategischer Ausdauer – der Fähigkeit, langfristig und beharrlich an einer Vision zu arbeiten. Diese fehlende „Stamina“ könnte sich als entscheidender Nachteil erweisen. Ein anschauliches Beispiel für diese strategische Differenz liegt in der Nukleartechnik.
China hat vor Kurzem ein kleines experimentelles Thorium-Molten-Salt-Reaktorprojekt (MSR) vorgestellt, das weltweit wohl eine Premiere darstellt: Das öffentliche Nachfüllen des Reaktors während des Betriebs, ohne diesen abschalten zu müssen. Das Projekt zeigt nicht nur innovative Technik, sondern auch die Bereitschaft Chinas, Technologien aufzugreifen, weiterzuentwickeln und strategisch zu verfolgen – selbst wenn der Westen diese bereits verworfen hat. Thorium als Nuklearbrennstoff bietet viele Vorteile. Es ist deutlich häufiger vorhanden als Uran, fungiert zugleich als Brennstoff und Kühlmittel und kann darüber hinaus nukleare Abfälle abbauen. Historisch betrachtet hat sich der Westen auf Uran- und Plutonium-basierte Brennstoffzyklen konzentriert und war wenig geneigt, alternative Technologien wie Molten-Salt-Reaktoren voranzutreiben.
Selbst bedeutende Stimmen wie Edward Teller, der Vater der Wasserstoffbombe, kritisierten die Einstellung der Thoriumforschung und sahen darin eine verpasste Chance. Im Gegensatz dazu nahm China die öffentlich zugänglichen, seit Jahren zurückgestellten Forschungsunterlagen aus den USA auf und baute darauf seine Technologie auf, ohne dabei auf geheimen Diebstahl angewiesen zu sein. Diese Haltung setzt ein starkes Signal: China versteht es, Forschungsergebnisse anderer zu nutzen, wenn diese vorhandene Potentiale hinterlassen und ihrerseits den langen Atem für Entwicklung aufbringen. Der Vergleich zwischen dem „Hasen“, also dem Westen, und der „Schildkröte“, also China, wurde von Xu Hongjie, einem erfahrenen Kerntechnikingenieur des Shanghai Institute of Applied Physics, eindrucksvoll formuliert. Er betont, dass technologische Führung von „strategischer Ausdauer“ abhängt – der Fähigkeit, über Jahrzehnte das gleiche Ziel zu verfolgen, auch wenn Rückschläge auftreten oder das Interesse sinkt.
Der Westen hingegen wirke oft von kurzfristigen politischen und wirtschaftlichen Zwängen getrieben, zeigte sich unbeständig und neigte zum Aufgeben, sobald Probleme oder Herausforderungen auftauchten. Die Realität bestätigt diese Sichtweise auf vielen Ebenen. Während China derzeit 58 kommerzielle Atomreaktoren am Netz hat und weitere Dutzende gebaut werden, sind westliche Länder in Bezug auf den Ausbau ihrer Nuklearanlagen zögerlich und langsam. In Großbritannien oder anderen europäischen Staaten dauern Planungen und Genehmigungsverfahren oft Jahre, während China mit seinem zentralisierten politischen System größere Infrastrukturprojekte schneller realisieren kann. Zudem fehlen in westlichen politischen und wissenschaftlichen Kreisen häufig Fachleute mit tiefgreifendem technischem Hintergrund, was den Innovationsprozess zusätzlich hemmt.
Auch die Atomindustrie insgesamt steht im Westen vor kaum zu überwindenden Hürden. Reaktorbauer werden durch steigende Kosten, öffentliche Skepsis und zunehmend komplexe Sicherheitsanforderungen behindert. Deutschland zum Beispiel verabschiedet sich bis 2024 endgültig von der Kernenergie, während Frankreich, traditionell ein starker Befürworter der Nuklearenergie, ebenfalls mit großen Herausforderungen kämpft, gleichwohl versucht, seine bestehenden Anlagen am Netz zu halten und weiterzuentwickeln. Ein nahezu metaphorischer Gegensatz bildet Chinas „strategische Stamina“ und die westliche „schnelle Erschöpfung“. Letztere zieht sich wie ein roter Faden durch viele Bereiche von Technologien, Infrastruktur, Klimaschutz und Energiepolitik.
Politikexperten fokussieren sich häufig auf marginale Verbesserungen und kurzfristige Maßnahmen, anstatt stabil und konsequent an langfristigen Lösungen zu arbeiten. Das führt zu einem Zustand, in dem wichtige Projekte immer wieder verzögert oder verworfen werden, da es an politischem Willen, öffentlicher Unterstützung oder schlicht am Durchhaltevermögen fehlt. Diese Entwicklung wirft grundsätzliche Fragen auf: Wie werden zukunftsweisende Technologien gefördert und langfristig umgesetzt? Welche Rolle spielen staatliche Planung und Unterstützung im Gegensatz zu kurzfristiger Marktlogik? Und welche Bedeutung hat eine nachhaltige technologische Unternehmenskultur, die Innovation nicht nur als Sprint, sondern als Marathon betrachtet? In einem breiteren zivilisatorischen Kontext ist die Diskrepanz zwischen China und dem Westen tiefgreifend. Laut Experten wie James Woudhuysen sind es nicht Kommunikation oder psychologische Faktoren, die Zivilisationen definieren, sondern das Produktionsvermögen und die Fähigkeit, bedeutende technische und infrastrukturelle Leistungen hervorzubringen. Wenn Gesellschaften aufhören, wichtige Dinge ernst zu nehmen, drohen kulturelle und wirtschaftliche Rückschritte – ein Prozess, der über Jahrtausende immer wieder beobachtet werden konnte.
Vor diesem Hintergrund ist Chinas neue technologische Offensive und der Spott über den vermeintlichen Mangel an Strategie und Ausdauer im Westen mehr als nur ein diplomatischer Schlagabtausch. Es geht um die Frage, wer die Zukunft gestalten wird. Wer die Fähigkeit besitzt, Herausforderungen zu meistern, enorme Ressourcen zu mobilisieren und über lange Zeiträume visionäre Projekte konsequent durchzuziehen, wird in den kommenden Jahrzehnten dominieren. Der Westen muss sich dieser Wirklichkeit stellen und kritisch reflektieren, wie technologische Entwicklungen gefördert und aufrechterhalten werden können. Es bedarf eines Umdenkens, das Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gleichermaßen betrifft.
Nur mit einem neuen Bewusstsein für die Bedeutung von „strategischer Stamina“ lassen sich zukunftssichere Infrastrukturen, Technologien und Ressourcenstrategien etablieren. Zudem ist es essenziell, dass Experten aus Wissenschaft und Ingenieurwesen stärker in politische Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Nur so kann Innovation in den Bereichen Atomenergie, künstliche Intelligenz, erneuerbare Energien und Infrastruktur das nötige Fundament erhalten, um langfristige Fortschritte sicherzustellen. Die fortschreitende Spezialisierung und das Auseinanderdriften zwischen Technik und Politik sind der Entwicklung nicht förderlich. Schließlich liegt es auch an der Gesellschaft als Ganzes, einen Wandel zu unterstützen, der über kurzfristige Vorteile hinausblickt und strategische Risiken mit einem langen Zeithorizont abwägt.
Bildung und die Vermittlung einer Kultur des Durchhaltens, Lernens aus Fehlern und der Bereitschaft zu kontinuierlicher Verbesserung können hierzu beitragen. Die Herausforderung ist immens, doch die jüngsten Entwicklungen in China und das Selbstverständnis ihrer Führung zeigen, wie wichtig es ist, nicht nur gute Ideen zu haben, sondern sie auch konsequent und nachhaltiger umzusetzen. Die strategische Ausdauer, von der China heute spricht, ist ein Schlüsselbegriff für jene, die auch künftig in einer komplexen, zunehmend technologiegeprägten Welt bestehen wollen. Die Frage lautet daher nicht mehr nur, wer die besten Technologien besitzt, sondern wer die Geduld, Disziplin und den Willen hat, langfristig und unbeirrt an Lösungen zu arbeiten. China lacht im Moment über die mangelnde „Stamina“ im Westen – zu Recht.
Es bleibt zu hoffen, dass diese Kritik ein Weckruf ist und der Westen das nötige Durchhaltevermögen findet, um den Herausforderungen der Zukunft erfolgreich zu begegnen.