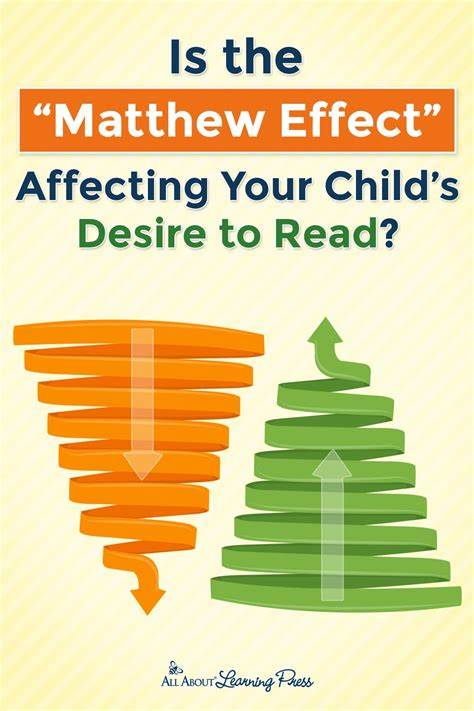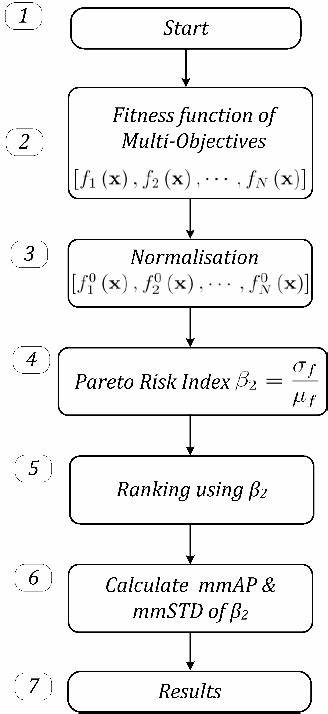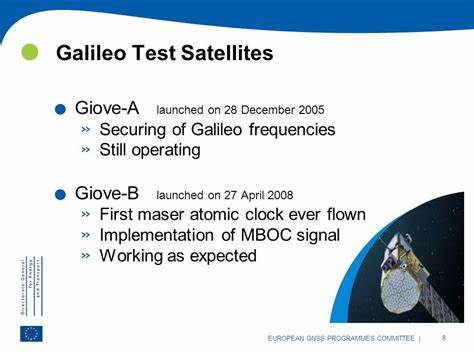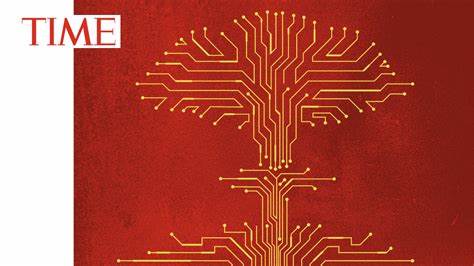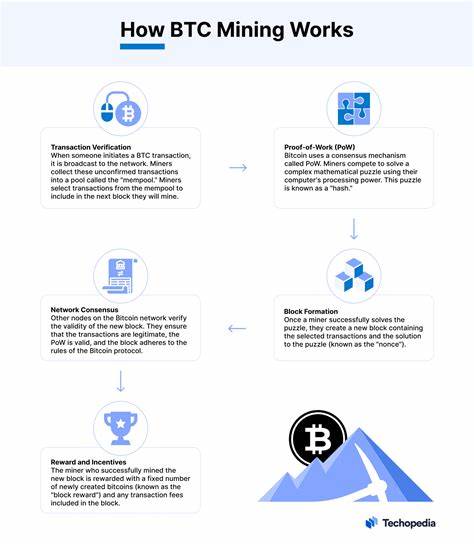Der Begriff Matthew-Effekt entstammt einem biblischen Gleichnis und wurde vom Soziologen Robert K. Merton geprägt, um ein weitverbreitetes Phänomen in der Wissenschaft zu beschreiben: Wer bereits viel Anerkennung, Sichtbarkeit und Prestige besitzt, erhält fortwährend noch mehr davon, während weniger bekannte Forscher häufig im Schatten bleiben. Das Sprichwort „Denn dem, der hat, dem wird gegeben werden, und er wird im Überfluss haben, aber von dem, der nicht hat, wird sogar das genommen, was er hat“ fasst diese Dynamik prägnant zusammen. Trotz der scheinbaren Ungerechtigkeit birgt der Matthew-Effekt sowohl positive als auch negative Aspekte für die Wissenschaft im Allgemeinen und für einzelne Forscherkarrieren im Besonderen. Das Beispiel des britischen Chemikers Harold Kroto illustriert die Mechanismen hinter dem Matthew-Effekt eindrücklich.
Im Jahr 1996 lehnte ein britisches Expertengremium eine Förderungsanfrage von Kroto ab. Nur wenige Stunden später wurde ihm jedoch der Nobelpreis für Chemie zugesprochen – gemeinsam mit seinen Kollegen Robert Curl Jr. und Richard Smalley – für ihre Entdeckung der Fullerene, einer neuen Molekülform aus Kohlenstoff. Die Vergabe des Nobelpreises zwang die britische Förderinstitution, ihre ursprüngliche Entscheidung zu revidieren. Der Preis öffnete Kroto Türen in den exklusiven Kreis der „sichtbaren“ Wissenschaftler, deren wissenschaftliche Beiträge automatisch mehr Beachtung erfahren.
Dieses Beispiel zeigt, wie prestigeträchtige Auszeichnungen als Verstärker fungieren und das Renommee eines Forschers exponentiell wachsen lassen können. In wissenschaftlichen Fachzeitschriften ist der Matthew-Effekt ebenfalls gut dokumentiert. Studien von Merton und seinen Schülern belegen, dass Manuskripte, die von Nobelpreisträgern oder besonders bekannten Wissenschaftlern verfasst wurden, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, angenommen zu werden. Auch die Zitierhäufigkeit wissenschaftlicher Veröffentlichungen steigt deutlich, wenn deren Autor bereits einen renommierten Preis erhalten hat. Dies bedeutet, dass nicht nur der Zugang zu Fördermitteln und Ressourcen begünstigt wird, sondern auch die Verbreitung und Anerkennung von Forschungsergebnissen durch diesen Effekt verstärkt wird.
Die Entstehung des Matthew-Effekts lässt sich auf eine Reihe von sozialen und strukturellen Faktoren zurückführen. Die Wissenschaft ist ein soziales System, das auf gegenseitiger Anerkennung fußt. Forschende müssen ihre Arbeit innerhalb ihrer Gemeinschaft sichtbar machen, um weitere Unterstützung zu erhalten – sei es durch Fördergelder, Kooperationen oder Publikationsmöglichkeiten. Da allerdings die Kapazitäten begrenzt sind, entwickelt sich eine Art Hierarchie, in der Forschungserfolge bekannter Wissenschaftler stärker gewichtet werden. Diese Dynamik ist nicht immer gerecht, aber in gewisser Weise auch funktional für das Wissenschaftssystem: Durch die Konzentration von Aufmerksamkeit auf wenige bekannte Beispiele wird die Gesamtübersichtlichkeit verbessert, und potenziell wichtige Entdeckungen werden leichter wahrgenommen und weiterverfolgt.
Während der Matthew-Effekt für die Wissenschaft als Kollektiv vorteilhaft sein kann, ist er für einzelne Karrieren oft eine Herausforderung. Insbesondere junge und unbekannte Forscher haben es schwer, überhaupt wahrgenommen zu werden. Der Zugang zu Fördergeldern, Publikationsmöglichkeiten oder hochkarätigen Konferenzen bleibt ihnen häufig verwehrt, bis sie eine gewisse Bekanntheit erlangt haben. Dies kann zu einer Art „Teufelskreis“ führen, der Innovationen hemmt und talentierte Köpfe daran hindert, ihr volles Potenzial zu entfalten. Die Ungleichheit macht es ferner schwierig, den tatsächlichen Beitrag einzelner Wissenschaftler korrekt zu bewerten, denn oft werden auch vom Team geleistete Arbeiten weniger sichtbar, wenn der Hauptautor bereits ein hohes Ansehen genießt.
Die Karriere von Lord Rayleigh, Nobelpreisträger für Physik im Jahr 1904, ist ein berühmtes Beispiel für die Wirkung der Sichtbarkeit innerhalb der Wissenschaft. Merton berichtete, dass eine seiner Arbeiten zunächst von einer wissenschaftlichen Kommission abgelehnt wurde, weil sein Name versehentlich auf dem Manuskript fehlte. Die Kommission hielt den unbekannten Autor für jemanden, der nur ungewöhnliche oder unerwartete Behauptungen aufstellte, sogenannten „Paradoxern“. Erst als Rayleighs Identität bekannt wurde, wurde das Manuskript akzeptiert. Diese Episode zeigt, wie sehr die Anerkennung mit dem Namen des Autors verbunden ist und wie schwer es ist, unabhängige Forschungsergebnisse isoliert von der Autorenschaft zu beurteilen.
Der Matthew-Effekt lässt sich nicht auf die Wissenschaft alleine beschränken. Er greift auch in anderen Bereichen wie Kultur, Medien oder Politik. Eine überschaubare Gruppe von Persönlichkeiten erlangt durch einen ersten Erfolg dauerhafte Sichtbarkeit, die ihnen wiederum weitere Möglichkeiten öffnet. Auch hier gilt das Prinzip: „Wer viel hat, dem wird gegeben.“ Für die Wissenschaft übersetzt sich diese Dynamik in Förderentscheidungen, Preisvergaben, Medienaufmerksamkeit und Zugang zu einflussreichen Netzwerken.
Oftmals behindert die Verfestigung von Eliten und Favoriten jedoch die Vielfalt und die Chance auf Neuerungen. Trotzdem bleibt der Nobelpreis als Paradebeispiel für die Macht des Matthew-Effekts unbestritten. Der Gewinn dieses Preises bietet weit mehr als eine finanzielle Belohnung. Er wirkt wie ein universeller „Zugangsschlüssel“ zu akademischen, politischen und wirtschaftlichen Institutionen weltweit. Der Nobelpreis öffnet Türen, die zuvor verschlossen waren, und verschafft den Preisträgern großen Einfluss und Öffentlichkeit.
Prominente Wissenschaftler wie Kary Mullis, Physik-Nobelpreisträger 1993, betonten, wie der Preis ihnen unvergleichliche Möglichkeiten eröffnete. Die hohe Nachfrage nach Vorträgen und Medienauftritten steigt sprunghaft an, was es ihnen erlaubt, sowohl die Bedeutung ihrer Forschung besser zu kommunizieren als auch neue Förderungen zu erhalten. Mit dem Ruhm gehen jedoch auch unerwünschte Begleiterscheinungen einher. Zahlreiche Nobelpreisträger berichten von einer Flut unerwünschter Korrespondenz, Anfragen und Medieninteresse, die mitunter als belastend empfunden werden. Marie Curie beispielsweise beklagte sich noch im Jahr 1903 über die Vielzahl an Briefen und Medienbesuchen nach ihrer ersten Nobelpreisverleihung.
Francis Crick, der zusammen mit James Watson den Nobelpreis für Medizin 1962 erhielt, entwickelte sogar standardisierte Antworten, um auf Einladungen und Interviewanfragen reagieren zu können, da die Zahl der Anfragen seinen Alltag überforderte. Diese Schattenseiten zeigen: Der Ruhm, der mit dem Matthew-Effekt einhergeht, kann auch zur Belastung werden, da er Wissenschaftler zunehmend zum öffentlichen Mittelpunkt macht. Manche Preisträger versuchen, diese Aufmerksamkeit auch politisch oder gesellschaftlich zu nutzen. 1992 unterzeichneten über hundert Nobelpreisträger - darunter Persönlichkeiten wie Salvatore Luria oder Richard Nixon - einen Aufruf für Frieden in Kroatien. Solche Aktionen zeigen, dass der Matthew-Effekt nicht nur das Wissenschaftssystem durchdringt, sondern auch die gesellschaftliche Verantwortung und den Einfluss von Wissenschaftlern auf politische Debatten stärkt.
Insgesamt beschreibt der Matthew-Effekt ein ambivalentes Phänomen. Er fördert die Konzentration von Ressourcen und Aufmerksamkeit auf wenige prominente Wissenschaftler, was einerseits die Effizienz des Wissenschaftsbetriebs steigern kann. Andererseits verstärkt er soziale Ungleichheiten und erschwert den Einstieg neuer Talente. Die Wissenschaft hat somit die Herausforderung, Mechanismen zu entwickeln, die zwar die Vorteile der Sichtbarkeit nutzen, zugleich aber die Chancengleichheit wahren und Diversität ermöglichen. Die Arbeit von Massimiano Bucchi hebt diese Aspekte hervor und zeigt, wie die öffentliche Wahrnehmung von Wissenschaft stark von solchen sozialen Dynamiken geprägt wird.
Der Matthew-Effekt ist nicht nur ein soziologisches Konzept, sondern beeinflusst ganz konkret die Karrierewege von Forschern, die Entwicklung von Forschungsschwerpunkten und die gesellschaftliche Relevanz wissenschaftlicher Ergebnisse. Wer diese Mechanismen versteht, kann sie auch gezielt hinterfragen und gegebenenfalls reformieren, um die Wissenschaft demokratischer und offener zu gestalten. Die Sichtbarkeit und Anerkennung in der Wissenschaft ist also ein zweischneidiges Schwert. Einerseits gibt es kaum einen Anreiz, innovative Forscher und bahnbrechende Forschung zu übersehen, wenn ein angesehener Name allein dafür sorgt, dass Ideen Gehör finden. Andererseits besteht die Gefahr, dass Wissenschaftler ohne bereits vorhandenes Renommee systematisch benachteiligt werden.
Der Matthew-Effekt veranschaulicht, dass wissenschaftlicher Erfolg nicht allein aus der Qualität der Forschung resultiert, sondern auch aus sozialen Prozessen der Anerkennung und Zuschreibung. Ein Bewusstsein dafür ist essenziell, um das Wissenschaftssystem gerechter und produktiver zu gestalten.