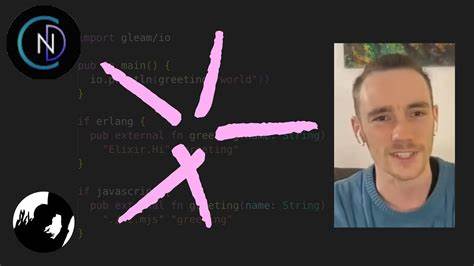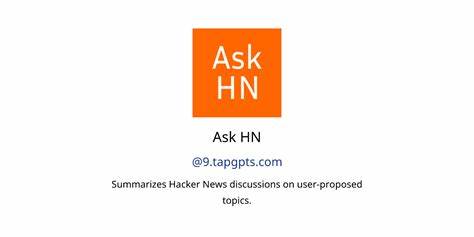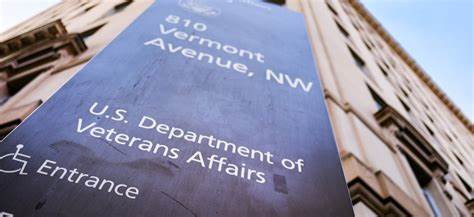In der Welt der funktionalen Programmierung hat sich die Erlang VM, auch bekannt als BEAM, seit Jahrzehnten als eine der robustesten und zuverlässigsten Laufzeitumgebungen etabliert. Mit ihrem Fokus auf Nebenläufigkeit, Fehlertoleranz und verteilte Systeme glänzt sie vor allem im Bereich von Soft-Realtime-Anwendungen. Trotz ihrer vielen Stärken stoßen Entwickler beim Einsatz der klassischen Erlang-Sprache manchmal an Grenzen hinsichtlich des Typsystems und der Ausdrucksstärke. Genau hier setzt Gleam an, eine statisch getypte Programmiersprache, die an die ML-Familie erinnert und für die Erlang VM entwickelt wurde. Wir werfen einen tiefgehenden Blick auf Gleam anhand eines Interviews mit Louis Pilfold, dem Schöpfer dieser Sprache.
Louis Pilfold ist kein Unbekannter im Bereich der Programmiersprachenentwicklung. Trotz seiner beruflichen Laufbahn als Webprogrammierer widmete er sich in den letzten Jahren intensiv Compiler-Technologie. Projekte wie Dogma, ein Elixir-Compiler, und exfmt, ein Formatter für Elixir, zählen zu seinen herausragenden Arbeiten. Gleam ist sein jüngstes und ambitioniertestes Projekt. Inspiriert von Sprachen wie Haskell und ML, wollte er eine Sprache schaffen, die die Stärken von Erlang mit moderner, statischer Typisierung verbindet.
Warum Erlang VM? Erlang hat sich vor allem durch seine einzigartige Laufzeitumgebung mit leichtgewichtigen Prozessen, preemptivem Scheduling und dem berühmten "Let it crash"-Philosophie hervorgetan. Die VM unterstützt eine Vielzahl an Bibliotheken und Tools, darunter Lasp für verteilte Systeme oder Riak Core für skalierbare Backend-Architekturen. Gleam nutzt diesen stabilen und bewährten Unterbau und verleiht ihm eine neue Syntax und ein leistungsfähiges Typsystem. Eine häufig geäußerte Kritik an Erlang ist die Einfachheit der Sprache mit fehlendem Support für Summentypen und fehlender Typensicherheit auf dem Kompilierschritt. Gleam will genau hier Abhilfe schaffen und bietet ein Hindley-Milner-basiertes Typsystem, das Entwickler vor vielen Fehlern schützt und dennoch die Flexibilität der Erlang-Ökosysteme erhält.
Das bedeutet, dass Fehler durch die statische Typprüfung bereits beim Kompilieren erkannt werden können, was die Entwicklung sicherer und effizienter gestaltet. Die Designentscheidungen bei Gleam sind bewusst zurückhaltend, um die Integration in bestehende Erlang- oder Elixir-Projekte zu erleichtern. Zum Beispiel wird der Gleam-Code nicht direkt in BEAM Bytecode kompiliert, sondern in gut lesbaren und wartbaren Erlang-Quellcode übersetzt. Dies eröffnet einen nahtlosen Workflow, bei dem Gleam-Module neben konventionellen Erlang- oder Elixir-Modulen genutzt werden können, ohne dass komplexe Tool-Abhängigkeiten entstehen. Besonders bemerkenswert ist, dass Gleam's Compiler vollständig in Rust implementiert wurde.
Diese Entscheidung stellt einen direkten Bruch mit der Tradition vieler BEAM-Sprachen dar, die meist in Erlang oder Elixir selbst oder in bewährten BEAM-Sprachen geschrieben sind. Rust verbindet dabei die typische Ausdruckskraft von ML-Sprachen mit niedrigem Overhead und fein kontrolliertem Speicher-Management, was zu einem performanten und wartbaren Compiler führt. In der Tat hebt Louis hervor, dass die statische Typisierung von Rust ihm half, den komplexen Typer der Sprache besser zu entwickeln und nachträgliche Refaktorisierungen ohne großen Aufwand zu ermöglichen. Gleam greift viele Ideen aus der ML-Welt auf, wie zum Beispiel starke Typinferenz, Möglichkeiten zur Typanpassung von Modulen und sogenannte Row-Typen, die flexible Strukturen für Records und Module erlauben. Allerdings wurden auch bewusst ML-typische Sprachfeatures ausgelassen, um der Erlang-Philosophie treu zu bleiben.
Dazu gehört das Fehlen von Auto-Currying oder eines Effektsystems. Auch eine spezielle Syntax mit geschweiften Klammern und ein Erlang-ähnliches Modulsystem tragen dazu bei, dass die Sprache sowohl für BEAM-Veteranen als auch für Neueinsteiger verständlich bleibt. Die statische Typisierung bei Gleam verschwindet vollständig zur Laufzeit, was bedeutet, dass es keine Performance-Einbußen durch Laufzeit-Typprüfungen gibt. Allerdings hat das den Nachteil, dass bei der Nutzung von dynamischen, unzuverlässigen Erlang-Funktionen spezielle Laufzeitmodule verwendet werden müssen, um die Typunsicherheit abzufangen. Aus Sicht der Zukunft sieht Louis hier noch enormes Potenzial für Verbesserungen, etwa in Form von typisierten Nachrichten und Protokoll-Spezifikationen, um das stark nebenläufige Modell der BEAM besser abzubilden.
Aktuell wird die Integration von Nebenläufigkeit und OTP-Verhalten über die Module realisiert, und niedrigere BEAM-spezifische Features sollen über das Erlang Foreign Function Interface (FFI) angebunden werden. Im Interview wird auch deutlich, dass Gleam nicht als weiteres komplett neues ML-Dialekt-Projekt verstanden wird, sondern als pragmatische Erweiterung des BEAM-Ökosystems mit dem Ziel, Produktionseinsatz zu ermöglichen. Die Entwickler wünschen sich zahlreiche Projekte in diesem Bereich und würden sich über ein gesundes Zusammenwachsen der verschiedenen Initiativen freuen. Was die Zukunft von Gleam betrifft, gibt es spannende Pläne. Dazu gehören die Erweiterung bei der Repräsentation von Atomen auf Typ-Ebene, was eine granularere Steuerung von Enum-ähnlichen Werten ermöglichen würde.
Auch die Einführung von Features wie Record-Punning könnte das Schreiben von Code eleganter machen. Darüber hinaus denkt das Entwicklerteam über alternative Compiler-Backends nach, etwa um JavaScript-Code oder native ausführbare Dateien zu erzeugen. Das ist vor allem interessant, weil es die Einsatzmöglichkeiten von Gleam über die traditionelle BEAM-Welt hinaus erweitern könnte, zum Beispiel für Cloud-Funktionen oder Kommandozeilen-Tools. Eine wertvolle Empfehlung von Louis an angehende Spracheentwickler betrifft die Bedeutung der Sprachexperimentierung vor dem Bau eines Compilers. Es gelte, das Design der Sprache erst im Kleinen zu verfeinern und zu durchdenken, bevor die komplexe Entwicklung eines Compilers startet.
Syntax und Semantik sollten gut geplant sein, da Änderungen nach Kompilierungsimplementierung sehr aufwendig sein können. Abschließend lässt sich sagen, dass Gleam eine faszinierende Alternative für Entwickler bietet, die die Stabilität und Zuverlässigkeit der BEAM-Umgebung schätzen, aber nicht auf moderne statische Typisierung verzichten möchten. Mit einem kompakten, leistungsfähigen Compiler in Rust und einer Syntax, die pragmatische Integration in bestehende Systeme ermöglicht, könnte Gleam sich zu einem wichtigen Baustein in der Sprachelandschaft rund um Erlang und Elixir entwickeln. Das Projekt zeigt eindrucksvoll, wie bewährte Technologien mit neuen Sprachideen kombiniert werden können, um den Herausforderungen moderner Softwareentwicklung gerecht zu werden. Durch die Kombination aus Produkttauglichkeit, moderner Typisierung und cleverer Nutzung der BEAM Infrastruktur eröffnet Gleam spannende Möglichkeiten für die Zukunft der funktionalen Programmierung im verteilten Kontext.
Wer sich für zukunftsfähige Sprachen auf der Erlang VM interessiert, sollte Gleam auf jeden Fall im Blick behalten.