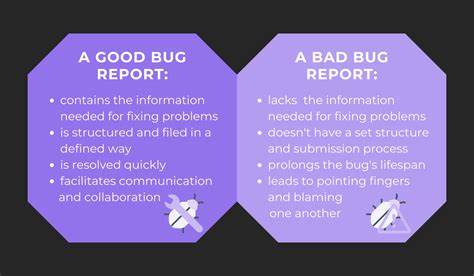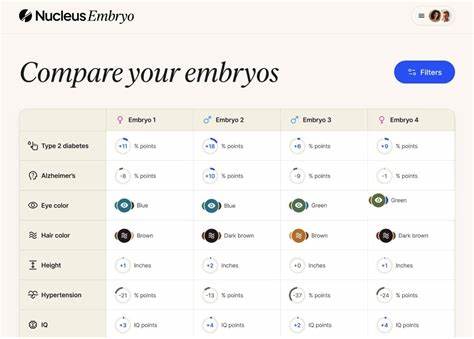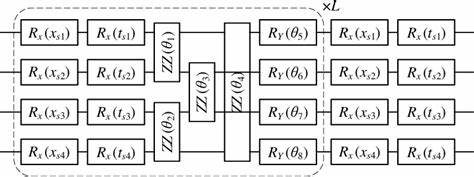Die internationalen Gewässer, oft als die hohen Seegebiete bezeichnet, umfassen mehr als die Hälfte der Erdoberfläche und stellen das größte zusammenhängende Ökosystem unseres Planeten dar. Mit über 60 Prozent der Ozeane und fast 43 Prozent der Erdoberfläche sind sie Heimat für eine äußerst vielfältige Meeresfauna und -flora und spielen eine zentrale Rolle in der Stabilisierung des Weltklimas. Trotz ihrer enormen Bedeutung für das ökologische Gleichgewicht und die Regulation des globalen Kohlenstoffkreislaufs sind diese Gebiete jedoch bislang kaum geschützt – weniger als ein Prozent der hohen See besitzen derzeit Schutzstatus. Angesichts der zunehmenden Bedrohungen durch übermäßige Fischerei, Tiefseebergbau und potenzielle Öl- und Gasförderung ist es dringlicher denn je, die internationalen Gewässer dauerhaft vor jeglicher extraktiver Nutzung zu bewahren. Der Zustand der hohen See ist alarmierend.
Die intensive Ausbeutung begann bereits im 17. Jahrhundert mit dem Walfang und wurde im 20. Jahrhundert durch industrielle Fischerei, unter anderem auf Haie, Thunfisch und Tintenfische, massiv ausgeweitet. Die Folgen sind Depletion von Schlüsselarten, Zerstörung von Lebensräumen und massive Störungen im marinen Nahrungsnetz. Zusätzlich führt der Klimawandel zu Erwärmung der Schichten, Sauerstoffarmut und verringerter Nährstoffverfügbarkeit, was die Produktivität dieser Meeresregionen dramatisch schmälert und die Widerstandskraft der Ökosysteme schwächt.
Die biologischen Prozesse, wie der sogenannte biologische Pumpmechanismus, bei dem Meereslebewesen Kohlenstoff von der Oberfläche in tiefere Schichten transportieren, sind essenziell, um CO2 aus der Atmosphäre zu binden und so den Treibhauseffekt zu mildern. Trotz der katastrophalen Folgen für die Biodiversität und das Klima ist die Regulierung der Nutzung der hohen See bislang unzureichend und fragmentiert. Ein global verbindliches Schutzregime fehlte lange Zeit, was maßgeblich zu der fortschreitenden Übernutzung beitrug. Zwar wurde 2023 der UN-Vertrag zum Schutz der Biodiversität in Gebieten jenseits nationaler Hoheitsgewässer – auch als High Seas Treaty bekannt – verabschiedet, doch dessen Ratifizierung und Umsetzung ziehen sich hin. Bislang sind erst knapp die Hälfte der notwendigen 60 Länder dem Abkommen beigetreten, und viele der entscheidenden Mechanismen zur Durchsetzung fehlen noch.
Die Zeit drängt jedoch, denn ökologische Schäden und Artenverluste sind oft irreversibel und bedrohen die Grundlage der Lebensfähigkeit der Ozeane für kommende Generationen. Das Potenzial der hohen See als Kohlenstoffsenke ist immens. In Tiefen von bis zu mehreren Tausend Metern speichern dort lebende Organismen jährlich riesige Mengen kohlenstoffreichen Materials. Der Verlust großer Fisch- und Meeressäugerpopulationen, etwa von Walen, die mit ihren Wanderungen Nährstoffe vertikal im Wasserraum transportieren, unterminiert diesen natürlichen Kreislauf. Wird die Fischerei in tiefere Zonen ausgedehnt, etwa in die bislang wenig erforschte mesopelagische Zone, könnte dies die Kohlenstoffspeicherung empfindlich stören und das Klima dadurch weiter belasten.
Gleichzeitig dient diese Region vielen Tieren als wichtige Nahrungsquelle und Lebensraum. Ein weiterer elementarer Aspekt ist die Ungleichheit in Bezug auf die Nutzung der hohen See. Der Großteil der Fischfänge wird von wenigen wohlhabenden Volkswirtschaften mit hohem Kapitalaufwand durchgeführt, während viele Küstenstaaten, insbesondere in Entwicklungsländern, von dieser Ressource nicht profitieren. Hinzu kommen umfangreiche Subventionen für die Hochseefischerei, welche die wirtschaftliche Rentabilität vieler Fangflotten künstlich stützen und so Anreize für die Ausweitung der Fischerei trotz schrumpfender Bestände schaffen. Die damit verbundenen sozialen Probleme reichen von Menschenrechtsverletzungen, einschließlich ausbeuterischer Arbeitsbedingungen bis hin zu illegalen Fangpraktiken.
Ein kompletter Schutz der internationalen Gewässer würde eine gerechtere Verteilung der Ressourcen fördern und gleichzeitig die natürlichen Vorkommen regenerieren lassen. Die Zukunft der Tiefseebergbauindustrie wirft ebenfalls erhebliche Risiken auf. Zwar ist eine kommerzielle Ausbeutung von Bodenschätzen in den internationalen Gewässern noch nicht gestartet, doch über 30 Explorationsverträge wurden bereits vergeben. Die International Seabed Authority agiert bisher sowohl als Förderer als auch als Regulierungsorgan, was Interessenkonflikte erzeugt und Transparenz vermissen lässt. Die potenziellen Umweltschäden durch den Abbau von polymetallischen Knollen im Tiefseeboden, darunter die Freisetzung von jahrtausendealtem organischem Kohlenstoff und die Zerstörung von bislang unerforschten Habitaten, sind kaum abzuschätzen, aber wahrscheinlich irreversibel.
Vor allem in Zeiten, in denen alternative Technologien für grüne Energien mit weniger mineralischen Rohstoffen auskommen und ausreichend terrestrische Quellen existieren, erfordert der Schutz der Tiefe eine strengere Anwendung des Vorsorgeprinzips und eine klar definierte globale Haltung gegen eine Freigabe solcher Aktivitäten. Politisch und gesellschaftlich stehen wir damit an einem Scheideweg. Die Herausforderungen, die Umsetzung eines umfassenden Schutzes der hohen See zu realisieren, sind enorm und umfassen diplomatische Hürden, fehlende wissenschaftliche Daten und die Komplexität internationaler Zusammenarbeit. Dennoch gibt es ermutigende Beispiele, wie den Schutz der Antarktis im 20. Jahrhundert, die zeigen, dass internationale Gemeinschaften gemeinsame Lösungen für globale Umweltprobleme finden können.
Der Schutz der hohen See wäre kein Eingriff in legitime maritime Aktivitäten wie die Schifffahrt, wissenschaftliche Forschung oder Erholung, sondern würde lediglich extraktive Praktiken wie Fischfang, Ölförderung und Bergbau ausschließen. Die ökologischen und sozialen Gewinne für den gesamten Planeten wären gewaltig. Gesündere Meeresökosysteme fördern nicht nur die Artenvielfalt und Klimastabilität, sondern bieten auch ökologische Rückkopplungseffekte, die nationale Fischereien in Küstengewässern stärken könnten. Dies wäre insbesondere für viele Entwicklungsländer wichtig, die häufig auf nachhaltige Fischereierträge angewiesen sind. Die Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft sind sich zunehmend einig, dass das Schicksal der hohen See nicht länger ein Randthema sein darf.