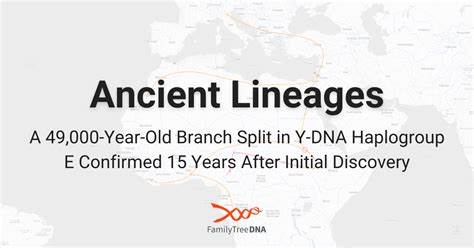Die Sahara, heute als größte heiße Wüste der Welt bekannt, war vor etwa 14.500 bis 5.000 Jahren vollkommen anders: Eine grüne, lebendige Savannenlandschaft erstreckte sich über ein riesiges Gebiet Nordafrikas. Während dieser sogenannten Afrikanischen Feuchtzeit – auch African Humid Period (AHP) – war der Lebensraum von Flüssen, Seen und üppiger Vegetation geprägt. Diese Umweltbedingungen förderten menschliche Besiedelung, vielfältige Jagd- und Herdwirtschaftspraktiken sowie kulturelle Entwicklung.
Doch trotz reicher archäologischer Funde blieben die genetischen Ursprünge der in dieser Zeit lebenden Menschen lange im Dunkeln, da die DNA in den herausfordernden Klimabedingungen der Sahara selten erhalten bleibt. Erst kürzlich konnten Forscher mithilfe von bahnbrechenden Verfahren alte genomische Daten von Individuen aus der Zentralen Sahara entschlüsseln. Im Fokus standen zwei etwa 7.000 Jahre alte weibliche Skelette aus dem Takarkori-Felsenschutzgebiet in der Tadrart Acacus Region im Südwesten Libyens. Diese Individuen stammen aus der Pastoral-Neolithikum-Periode, einer Epoche, in der die Viehzucht im zentralen Sahara-Gebiet Fuß fasste.
Die Genomanalysen zeigten, dass die meisten Vorfahren dieser Menschen einem bislang unbekannten, uralten nordafrikanischen Erbe entstammen, das sich vor Zehntausenden von Jahren von den sub-saharischen Bevölkerungen abspaltete und über lange Zeit weitgehend isoliert blieb. Die Takarkori-Genome weisen eine enge Verwandtschaft zu frühpleistozänen Jägern und Sammlern aus der Taforalt-Höhle in Marokko auf, die vor rund 15.000 Jahren lebten. Diese sogenannten Iberomaurusianer werden in Verbindung mit charakteristischen steinzeitlichen Werkzeugindustrien gebracht und waren bereits vor dem Beginn der Afrikanischen Feuchtzeit aktiv. Interessant ist, dass sowohl die Takarkori- als auch die Taforalt-Individuen in etwa gleich weit von den Genlinien der sub-saharischen Afrikaner entfernt sind.
Dies deutet darauf hin, dass es während der Grüner-Sahara-Phase keinen oder nur sehr wenig genetischen Austausch zwischen den Populationen südlich und nördlich der Sahara gab. Ein weiterer erstaunlicher Befund ist, dass die Takarkori-Menschen deutlich weniger Neandertaler-DNA besitzen als andere Populationen außerhalb Afrikas. Während die Taforalt-Gruppen eine Neandertaler-Mischung von etwa 0,6 bis 0,9 Prozent aufwiesen, besitzt Takarkori nur rund 0,15 Prozent – also etwa zehnmal weniger als andere häufig untersuchte Gruppen aus dem Nahen Osten oder Europa. Dennoch liegen diese Werte deutlich oberhalb der Neandertaler-Anteile in heutigen oder alten sub-saharischen Populationen, die praktisch keine Spuren dieser urzeitlichen Vermischung zeigen. Diese genetische Signatur spricht dafür, dass das Erscheinen der Viehzucht in der Sahara vor circa 8.
000 Jahren überwiegend durch kulturelle Diffusion erfolgte. Das bedeutet, dass bestehende Populationen im zentralen Sahara-Gebiet ihre Lebensweisen verändert und neue Techniken übernommen haben, ohne dass größere Bevölkerungsbewegungen oder -vermischungen mit Außenstehenden stattgefunden hätten. Archäologisch lässt sich diese Entwicklung durch Veränderungen in der Keramik, Werkzeuggattung und Bestattungstraditionen stützen. Somit waren sozialen und kulturellen Innovationen oft stärker als genetische Veränderungen für den Wandel der damaligen Gesellschaften verantwortlich. Die Fundstätte Takarkori ist selbst ein Fenster in die Geschichte der Grünen Sahara.
Ihre Ausgrabungen lieferten wertvolle Informationen über verschiedene Besiedlungsperioden vom späten Acacus-Jäger-und-Sammler bis hin zu einer pastoralistischen Gesellschaft. Die circa 15 bestatteten Individuen, vor allem Frauen und Kinder, erlauben detaillierte Studien zu sozialen Strukturen, Mobilität und Ernährung der damaligen Zeit. Strontium-Isotopenanalysen weisen darauf hin, dass die Menschen lokal verwurzelt waren und weite Wanderungen eher die Ausnahme denn die Regel darstellten. Die gewonnenen genetischen Daten repräsentieren für Nordafrika eine bisher unbekannte, eigenständige Abstammungslinie abseits der bekannten Genflüsse anderer Regionen. Die Vorfahren dieser Population könnten schon vor 60.
000 Jahren in Nordafrika lebtenet haben, lange bevor sich große Gruppen von Afrika nach Eurasien ausbreiteten. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die Nordafrikaner eine bemerkenswert stabile genetische Geschichte aufweisen, die durch spätere Vermischungen nur minimal beeinflusst wurde. Die Tatsache, dass diese alten Bevölkerungen weder viel Neandertaler-DNA noch genetische Spuren sub-saharischer Gene aufwiesen, unterstreicht die geografische und kulturelle Isolierung dieser Gruppen über Tausende von Jahren. Moderne genetische Studien zeigen heute eine ausgeprägte Differenzierung der Bevölkerung jenseits des Sahara-Gürtels. Die historische, ökologische und kulturelle Fragmentierung der Region könnte hierfür ein entscheidender Faktor sein.
So fungierte die Sahara trotz vereinzelter Grüner-Phasen als Barriere, die gene flow – also den genetischen Austausch – zwischen Nord- und Subsahara-Afrika verhemmte. Auch komplexe soziale und kulturelle Mechanismen erschwerten vermutlich eine durchgehende Vermischung. Darüber hinaus liefern die neuen Erkenntnisse aus dem Takarkori-Genom Antworten auf frühere Rätsel rund um die Herkunft der sogenannten Taforalt-Forager. Studien hatten zuvor ein Modell angenommen, wonach deren genetische Zusammensetzung sich aus rund 60 Prozent Levantinern (den Natufianern) und etwa 40 Prozent einer unbekannten sub-saharischen Herkunft zusammensetzte. Nun zeigt sich, dass letztere Herkunft keine sub-saharische Quelle sein muss, sondern vielmehr der tief verwurzelten nordafrikanischen Linie wie bei Takarkori entspringt.
Dies verändert unser Verständnis zur Bevölkerungsgenese in Nordafrika erheblich und verweist auf viel stärkere lokale Kontinuitäten als vermutet. Auch wenn die Grünen Sahara-Ereignisse während des Holozäns zu einer natürlicher Verbreitung von Flora, Fauna und menschlicher Kultur beitrugen, waren sie offenbar nicht ausreichend, um großflächige genetische Vermischungen hervorzurufen. Dies spiegelt sich auch in den heutigen genetischen Landschaften wider, in denen die Populationen Nordafrikas und Subsahara-Afrikas weiterhin deutliche Unterschiede zeigen, die über ihre räumliche Trennung hinausgehen. Die neue Datenlage bestärkt so die These, dass die Sahara vor allem historische, ökologische und soziale Grenzen bedeutete, die genetischen Austausch einschränkten. Die Erforschung der Grünen Sahara aus genomischer Sicht steht noch am Anfang.
Die jüngsten technologischen Fortschritte im Bereich der antiken DNA-Analyse versprechen jedoch eine Fülle an weiteren Erkenntnissen. Mit Sequenzierungsmethoden, die auch bei schwierigen klimatischen Bedingungen funktionsfähige Daten liefern können, wird in naher Zukunft mit vielen weiteren Entdeckungen gerechnet. Diese werden nicht nur helfen, die Fragen der Bevölkerungsbewegungen und Kulturentwicklungen im nördlichen Afrika genauer zu beantworten, sondern könnten auch das Gesamtbild der menschlichen Evolution auf dem afrikanischen Kontinent wesentlich bereichern. Abschließend zeigt die Forschung die Bedeutung der Grünen Sahara als Keimzelle einer alten, tiefen afrikanischen Abstammungslinie, die historisch isoliert und genetisch eigenständig war. Sie hat einen entscheidenden Platz im Puzzle der menschlichen Geschichte und verdeutlicht, wie natürliche und kulturelle Landschaften die genetische Vielfalt prägten.
Das Verständnis dieser Verbindungen ist nicht nur aus wissenschaftlicher Perspektive spannend, sondern hilft auch, das dynamische Bild der Menschheitsgeschichte mit all ihren regionalen Besonderheiten und globalen Verknüpfungen umfassender zu erfassen.