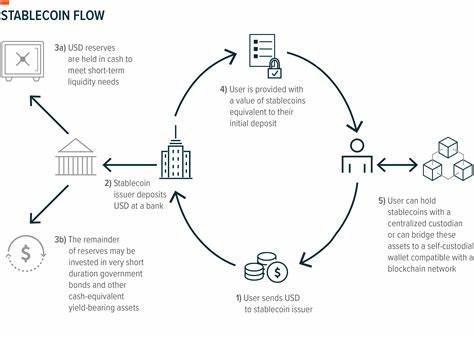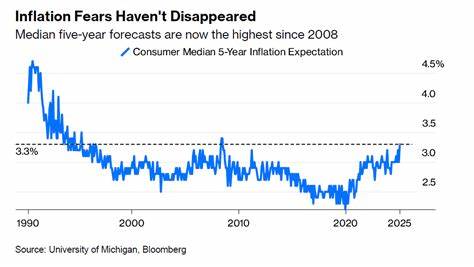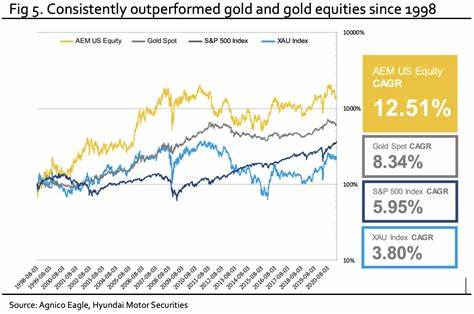Die Arbeitswelt befindet sich im Wandel. Die Corona-Pandemie hat viele Unternehmen gezwungen, ihre Arbeitsstrukturen kurzfristig neu zu gestalten und digitale Arbeitsformen zu etablieren. Mittlerweile setzen viele Firmen auf hybride Arbeitsmodelle, die eine Mischung aus Büroanwesenheit und Remote-Arbeit ermöglichen. Doch wie kann ein solcher hybrider Ansatz erfolgreich gestaltet werden? Die Antwort liegt laut einem aktuellen Bericht von Cisco vor allem in der aktiven Einbindung der Mitarbeiter in die Entscheidungsprozesse rund um Homeoffice und Rückkehr ins Büro. Hybridarbeit bedeutet nicht einfach, dass alle Mitarbeiter jederzeit beliebig von zu Hause aus arbeiten können.
Vielmehr geht es darum, die individuellen Bedürfnisse sowie die Aufgabenanforderungen zu berücksichtigen und flexible Lösungen anzubieten, die den unterschiedlichen Situationen gerecht werden. Dies zeigt sich besonders darin, dass Spitzenkräfte Flexibilität als entscheidenden Faktor für ihre Produktivität und Arbeitszufriedenheit sehen. Cisco betont, dass Flexibilität nicht gleichbedeutend mit Dauertalenten im Homeoffice ist, sondern vielmehr mit der Möglichkeit, auf persönliche und situative Anforderungen einzugehen. Laut der umfassenden Studie von Cisco, an der über 21.000 Arbeitnehmer und Arbeitgeber aus verschiedenen Branchen und Ländern teilgenommen haben, zeigen sich bemerkenswerte Erkenntnisse.
Rund drei Viertel der Unternehmen implizieren mittlerweile eine Rückkehr-Ins-Büro-(Return-to-Office, RTO)-Pflicht. Interessanterweise geben 73 Prozent der Befragten an, sich im Büro produktiver zu fühlen – im Schnitt gewinnen sie etwa einen ganzen Arbeitstag pro Woche durch die Anwesenheit vor Ort. Dies verdeutlicht, wie wichtig der physische Teamzusammenhalt für viele Belegschaften immer noch ist, denn neben Produktivität schätzen Mitarbeiter den sozialen Austausch und die Zusammenarbeit. Dennoch wird deutlich, dass starre Präsenzregeln nicht auf Akzeptanz stoßen. Etwa 77 Prozent der Arbeitnehmer vermuten, dass strikte Rückkehrvorgaben mit mangelndem Vertrauen der Arbeitgeber in ihre Selbstorganisation zu tun haben.
Dieses fehlende Vertrauen führt nicht nur zu Unzufriedenheit, sondern kann auch die psychische Gesundheit beeinträchtigen, da nur ein Bruchteil der Angestellten solche strikten Regeln als förderlich für ihr Wohlbefinden erlebt. Gerade die sogenannten Top-Performer haben klare Erwartungen. Für sie sind hybrid gestaltete Arbeitsmodelle inzwischen ein entscheidendes Kriterium bei der Arbeitgeberwahl. Rund 78 Prozent gaben an, einen Arbeitgeber verlassen zu wollen, der keine flexible Arbeitsgestaltung ermöglicht. Gleichzeitig erkennen viele beruflich erfolgreiche Mitarbeiter den Nutzen der Büropräsenz und sehen darin Chancen für ihre Karriereentwicklung.
Interessant ist, dass zwar nur ein Drittel von ihnen tatsächlich das Arbeiten im Büro bevorzugt, aber mehr als 80 Prozent darin Vorteile für ihre berufliche Laufbahn sehen. Diese Diskrepanz verdeutlicht, dass hybride Arbeit kein Entweder-oder ist, sondern eine Abstimmung verschiedener Anliegen erfordert – Mitarbeiter wollen Freiräume und Autonomie, gleichzeitig aber auch die Möglichkeit zum Austausch und zur Zusammenarbeit in der Gemeinschaft. Cisco empfiehlt daher, hybride Arbeit nicht als starre Regelung, sondern als dynamisches und dialogbasiertes Modell zu verstehen. Führungskräfte sollten den offenen Dialog mit ihren Teams suchen und gemeinsam Klärung schaffen, wie Zusammenarbeit am besten funktioniert. Klare Kommunikation erweist sich als ein zentraler Erfolgsfaktor.
Die Studie machte deutlich, dass nur etwas mehr als ein Drittel der Angestellten ihre Rückkehrpflichten und deren Hintergründe verständlich erklärt bekommen. Fehlende Transparenz hingegen sorgt für Unsicherheiten und fördert Widerstände. Viele Mitarbeiter wünschen sich, dass Führungskräfte die Ziele massgeschneidert erläutern: Warum ist es jetzt wichtig, öfter im Büro zu sein? Welche Leistungen und Ergebnisse sind erwartbar? Wie lässt sich die Balance zwischen Teamarbeiten und individueller Flexibilität sichern? Fran Katsoudas, Executive Vice President bei Cisco, hebt hervor, dass Führungskräfte unbedingt proaktiv auf ihre Mitarbeitenden zugehen müssen, um gemeinsam Arbeitsweisen zu gestalten. Die Fragen „Wie arbeiten wir am besten als Team?“, „Wie verbessern wir unsere Performance?“ oder „Welche Ziele streben wir an und wie oft müssen wir dafür physisch zusammenkommen?“ helfen, die unterschiedlichen Bedürfnisse zu adressieren und eine individuelle sowie nachvollziehbare hybride Lösung zu finden. Der Aufbau von Vertrauen ist gleichzeitig ein zentraler Hebel.
Unternehmen sollten Autonomie gewähren und den Mitarbeitenden Verantwortungsbereiche übertragen. Ein rigides Kontrollsystem auf der Basis von Anwesenheit allein hemmt hingegen die Motivation und Kreativität. Vielmehr müssen Führungskräfte deutlich machen, dass sie an den Ergebnissen und der Qualität der Arbeit interessiert sind und nicht am blinden Einhalten von Präsenzzeiten. Das fördert langfristig eine Unternehmenskultur, die auf Vertrauen und Wertschätzung baut und hybride Modelle nachhaltig trägt. Darüber hinaus spielen digitale Tools eine wichtige Rolle, um hybride Zusammenarbeit zu ermöglichen.
Plattformen für Kommunikation, Projektmanagement und Dokumentenaustausch sorgen dafür, dass trotz unterschiedlicher Standorte ein reibungsloser Informationsfluss herrscht. Dabei ist es essenziell, dass Technik benutzerfreundlich ist und Mitarbeitende entsprechende Schulungen erhalten, um mögliche Hürden zu reduzieren. Nicht zuletzt empfiehlt Cisco, die individuellen Situationen der Mitarbeitenden zu berücksichtigen. Familienstand, Pendelwege, persönliche Vorlieben und auch gesundheitliche Aspekte können die Präferenz für Heimarbeit oder Bürozeit beeinflussen. Wenn Arbeitgeber diese Aspekte einbeziehen und flexible Regelungen bieten, fühlen sich Angestellte besser unterstützt.
Die Zukunft der Arbeit ist hybrid – allerdings gelingt sie nur durch partizipative Entscheidungsprozesse und offene Kommunikation. Unternehmen sind gut beraten, ihre Teams einzubeziehen und gemeinsam flexible Modelle zu entwickeln, die sowohl den individuellen Bedürfnissen als auch den betrieblichen Anforderungen gerecht werden. Starre und unflexible Rückkehrregeln bergen nicht nur die Gefahr von Fluktuation, sondern können auch das Betriebsklima verschlechtern und die Produktivität mindern. Im Kern steht die Erkenntnis, dass hybride Arbeit kein allgemein gültiges Konzept ist, sondern eine hochgradig persönliche Arbeitsform, die unterschiedliche Leben realistisch abbildet. Wer hier auf Vertrauen, Transparenz und Kommunikation setzt, legt den Grundstein für eine moderne Arbeitswelt, die Mitarbeiter bindet, ihr Potenzial fördert und gleichzeitig die Leistung des Unternehmens stärkt.
Cisco macht damit deutlich, dass der Schlüssel für erfolgreiche hybride Arbeitsplätze in der Mitgestaltung und dem Dialog mit den Beschäftigten liegt – ein Ansatz, der auch in Zukunft immer wichtiger wird.