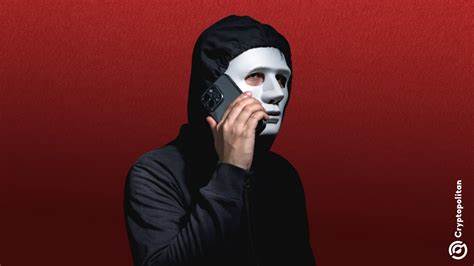Im April 2025 hat der ehemalige US-Präsident Donald Trump eine neue Zäsur in der Darstellung und Ausführung globaler Handelspolitik gesetzt. Unter dem euphemistischen Titel „Liberation Day“ verabschiedete die US-Regierung weitreichende Strafzölle auf Importwaren aus nahezu allen führenden Handelsnationen, darunter verbündete und vermeintliche Rivalen. Diese Maßnahmen trafen den Weltmarkt wie ein Schock und führten zu einer abrupten Verschiebung in der internationalen Wirtschaftsordnung. Was als ein politisches Manöver begann, entwickelte sich rasch zu einem weitreichenden Handelskrieg, der die Grundpfeiler der bisherigen globalen Handelsarchitektur ins Wanken bringt. Die Auswirkungen der „Liberation Day“-Zölle zeigen exemplarisch, wie das Ende der regelbasierten Globalisierung eingeläutet wurde und warum die Ära des freien Welthandels an ihre Grenzen geraten ist.
Bislang galt das von den Vereinigten Staaten maßgeblich geprägte Welthandelssystem als Eckpfeiler der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Es beruhte auf multilateralen Abkommen, die Regeln für fairen Handel, Zollabbau und die Schlichtung von Handelsstreitigkeiten setzten. Das System wurde insbesondere vom World Trade Organization (WTO) Mechanismus getragen, der eine Plattform für Verhandlungen und Regelsetzungen schuf. Die USA waren als globale Wirtschaftsmacht jedoch nie vollständig frei von protektionistischen Tendenzen, doch mit Trumps aggressiver Handelspolitik erreichte der Schlagabtausch eine neue Intensität und Tiefe. Die unmittelbare Folge der neuen US-Zölle war eine verheerende Reaktion der internationalen Märkte: Der S&P 500 verlor fast sechs Prozent an Wert, während Aktien von Unternehmen mit starkem China-Geschäft, wie Boeing, um über neun Prozent einbrachen.
Auch verschiedene asiatische Indizes, darunter der Nikkei und der KOSPI, erfuhren signifikante Verluste. Besonders bemerkenswert ist, dass China unmittelbar mit Vergeltungszöllen reagierte und alle US-Importe mit einem Satz von 34 Prozent belegte – der sogenannte „reziproke“ Zollsatz – und damit die Spirale der Eskalation beschleunigte. Diese Entwicklung zeigt, dass „Liberation Day“ nicht nur eine nationale US-Politik ist, sondern globale Konsequenzen hat. „Trump hat mit einem Vorschlaghammer auf den Handel mit nahezu jedem wichtigen Handelspartner der USA eingeschlagen“, resümierte der renommierte Cornell-Ökonom Eswar Prasad. Länder wie Japan, Südkorea und sogar enge US-Verbündete stehen nun vor der Herausforderung, mit den neuen Handelsbarrieren umzugehen und ihre Wirtschaft gegen negative Auswirkungen zu wappnen.
Das bisherige Bild eines offenen Welthandels, der allen beteiligten Nationen Nutzen bringt und Stabilität schafft, wird zunehmend durch protektionistische Maßnahmen und Gegenzölle ersetzt. Die wirtschaftlichen Prognosen für die betroffenen Länder sind alarmierend. Goldman Sachs senkte bereits die Wachstumsaussichten für viele asiatische Länder signifikant. Vietnam, das mit einer Zollbelastung von bis zu 49 Prozent konfrontiert ist, sieht einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 1,5 Prozentpunkte auf 5,6 Prozent. Für Taiwan, das einen Zollsatz von 32 Prozent erhält, wurde das Wachstumspotenzial sogar um ganze 1,0 Prozent auf 1,6 Prozent reduziert.
Die Handelsstreitigkeiten gehen somit weit über kurzfristige Marktverwerfungen hinaus und drohen das wirtschaftliche Fundament ganzer Regionen nachhaltig zu erschüttern. Einige Staaten versuchen zwar, die negativen Effekte durch eine Politik der Zugeständnisse abzumildern. So hat Vietnam wiederholt angekündigt, die Zölle für US-Importe deutlich zu senken, um als Handelspartner attraktiv zu bleiben. Ähnliche Maßnahmen wurden auch von Kambodscha und Taiwan angekündigt, die staatliche Förderprogramme für ihre heimische Industrie ins Leben gerufen haben, um den Schlag abzufedern. Doch unter dem Druck, sich einer neuen Handelssituation anzupassen, bleibt die Unsicherheit groß.
Denn der eigentliche Bruch liegt nicht nur in diesen bilateral verhängten Zöllen, sondern im fundamentalen Aufbrechen der bestehenden multilateralen Regeln. Besondere Brisanz hat die Aussage von Singapurs Premierminister Lawrence Wong, der prognostizierte, dass die Ära der regelbasierten Globalisierung und des freien Handels vorbei sei. Das System, das auf international abgestimmten Normen, starken Institutionen und gegenseitigem Vertrauen basierte, zeichne sich zunehmend durch Willkür, Protektionismus und ein gefährliches Machtgerangel aus. Ein globaler Rückzug von Verantwortungsträgern und eine stärkere Fokussierung auf nationale Eigeninteressen prägten mittlerweile das Verhalten vieler Staaten und unterminierten die internationale Zusammenarbeit. Die USA hatten über Jahrzehnte ihre ökonomische und politische Führungsrolle genutzt, um den multilateralen Austausch und das Regelwerk des Welthandels zu etablieren und zu verteidigen.
Trumps Politik symbolisiert einen Bruch mit dieser Tradition. Statt Reparatur und Reform des Systems tritt nun die Aufgabe des multilateralen Handelssystems an seine Stelle. Die zuvor scharf kritisierten Handelspartner erleben damit eine neue Konstellation: Einige versuchen kleine Zugeständnisse zu machen, um den Schaden zu begrenzen, andere nutzen die Gelegenheit, um ihre Marktanteile auszubauen oder Wirtschaftskooperationen ohne die USA zu fördern. Eine solche Neuausrichtung lässt sich unter anderem in der Reaktion der Philippinen beobachten. Trotz eines verhältnismäßig niedrigen Zollsatzes auf US-Waren nutzt das Land die Situation, um seine Exporte in den USA – insbesondere in Sektoren wie Elektronik und Landwirtschaft – zu steigern und einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Ländern mit höheren Zöllen zu erlangen.
Ebenso intensiviert China seine Bemühungen, neue Handelsbeziehungen besonders mit Ländern des Globalen Südens zu etablieren und so seine wirtschaftliche Position in einem sich verändernden Welthandel weiter zu festigen. Diese Entwicklungen werfen ein Licht auf die strukturelle Verschiebung im globalen Machtgefüge. Während die USA ökonomisch und politisch zurückweichen, manifestieren sich neue regionale und globale Handelspartner. Auch wenn die USA als Konsummarkt nach wie vor eine bedeutende Rolle spielen, ist der Einfluss auf die Gestaltung der internationalen Regeln gebrochen. Die Gefahr einer fragmentierten Weltwirtschaft, in der individuelle und kurzfristige Interessen dominieren, ist damit deutlich gestiegen.
Ökonomen und Experten warnen vor langfristigen Konsequenzen: Ein Welthandel ohne klare Führung und ohne einheitliche ,Spielregeln' erhöht die Wahrscheinlichkeit von Handelskriegen, die in Zeiten globaler Verflechtung zu erheblichen Produktivitätsverlusten, höheren Verbraucherpreisen und wirtschaftlicher Unsicherheit führen. Die Vorteile globaler Arbeitsteilung und Spezialisierung könnten verloren gehen, während politische Spannungen und Unberechenbarkeit sich verschärfen. Abschließend lässt sich festhalten, dass Trumps „Liberation Day“ als symbolisches Datum in die Geschichte eingehen dürfte. Er setzt nicht nur eine neue Ära marktwirtschaftlicher Herausforderungen in Bewegung, sondern fordert auch das Fundament der internationalen Handelsordnung heraus. Ob und wie sich die globale Wirtschaft an diese neue Realität anpassen wird, hängt maßgeblich von den zukünftigen politischen Entscheidungen der wichtigsten Akteure ab.
Die weltweite Handelsgemeinschaft steht am Scheideweg – zwischen einem Wiederaufbau multilateraler Zusammenarbeit oder einer Fragmentierung in protektionistische und national ausgerichtete Wirtschaftsblöcke. Die kommenden Jahre werden zeigen, wie nachhaltig der durch „Liberation Day“ ausgelöste Wandel sein wird und welche wirtschaftlichen und geopolitischen Konsequenzen sich daraus ergeben.