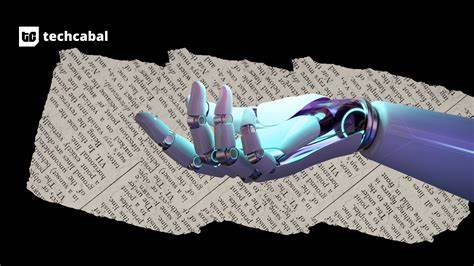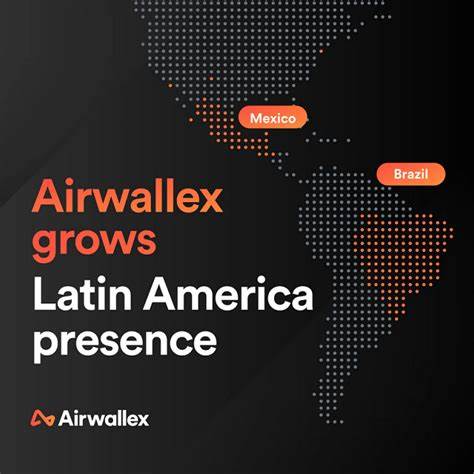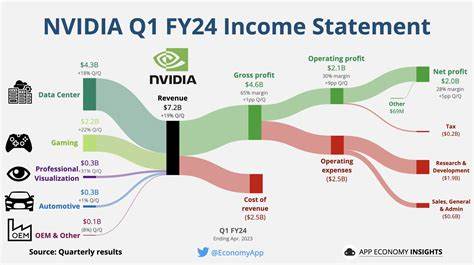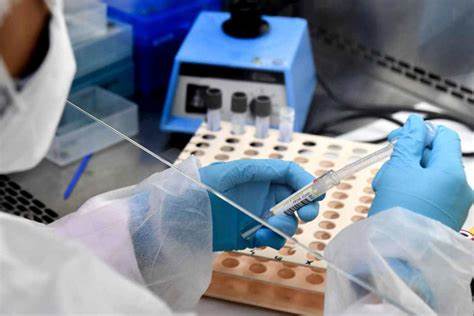Afrika steht an einem Scheideweg, wenn es um die Digitalisierung des Bildungssektors geht. Während der Kontinent weltweit als Vorreiter im Fintech-Bereich gilt, offenbaren die Bildungssysteme vieler afrikanischer Staaten nach wie vor gravierende Defizite. In manchen Ländern verlassen bis zu 90 Prozent der Kinder die Grundschule, ohne grundlegende Lesefähigkeiten erworben zu haben. Angesichts dieser Situation mag Künstliche Intelligenz (KI) als vielversprechende Lösung erscheinen, doch die Realität zeigt, dass Technologie allein nicht ausreicht, um das komplexe Bildungsproblem zu lösen. Um nachhaltige Veränderungen zu bewirken, müssen innovative Geschäftsmodelle, politische Einbindung und kulturelle Anpassungen Hand in Hand gehen.
Der große Unterschied zwischen Fintech und Edtech in Afrika ist bezeichnend: Während der Finanzsektor innerhalb kürzester Zeit 60 Prozent des gesamten Risikokapitals auf dem Kontinent anzieht, sind es im Bereich Bildung weniger als zwei Prozent. Fintech löst konkrete und dringende Bedürfnisse mit klaren Vorteilen – schnellere, günstigere und bessere Dienstleistungen, wie etwa Überweisungen. Hier gab es bereits eine bestehende Nachfrage, die die Technologie optimieren konnte. Im Bildungssektor hingegen werden oft neue Technologien entwickelt, ohne dass eine echte Nachfrage auf Seiten der Nutzer vorhanden ist. Das Auftauchen von KI als Innovationstreiber wird deshalb mit gemischten Gefühlen betrachtet.
Regierungen wie Nigeria treiben Trainingsprogramme für Lehrer in KI voran, was grundsätzlich positiv ist. Doch ähnliche Initiativen aus der Vergangenheit, etwa die „One Laptop Per Child“-Initiative vor zwanzig Jahren, haben gezeigt, dass technologische Lösungen ohne passende Infrastruktur, ausreichende Wartung und vor allem ohne Einbindung der Nutzer kaum eine nachhaltige Wirkung entfalten können. In mehreren Ländern und Regionen versagten solche Projekte an mangelnder Akzeptanz, fehlenden Ressourcen oder schlicht an nicht durchdachten Geschäftsmodellen. Das Versprechen, kostengünstige und personalisierte KI-Tutoren anzubieten, klingt vielversprechend, doch die Umsetzung bleibt anspruchsvoll. Ein mit KI unterstütztes Unterrichtshilfesystem via WhatsApp hat etwa in Kenia eine innovative Plattform gefunden, da WhatsApp über 200 Millionen Nutzer in Afrika zählt und somit die Reichweite gegeben ist.
Dennoch bleibt die Zahlungsbereitschaft der Nutzer kritisch: Die meisten Lehrer sind unterbezahlt und häufig stark belastet. Ein Jahresbeitrag von 10 bis 20 US-Dollar erscheint daher wenig realistisch, wenn nicht staatliche Stellen als Abnehmer gewonnen werden können. Die Realität ist, dass Staaten in Afrika etwa 70 Prozent der Bildungsausgaben stemmen. Edtech-Unternehmen, die sich ausschließlich auf Privatschulen oder internetaffine wohlhabende Eltern konzentrieren, erreichen demnach nur eine sehr kleine Nutzerschaft. Da rund 82 Prozent der Lernenden zuhause keinen Internetzugang und 95 Prozent kein zuverlässiges Smartphone haben, sind traditionelle digitale Modelle häufig kaum skalierbar oder nur mit erheblichen Einschränkungen einsetzbar.
Edtech muss demnach nicht nur technologisch innovativ sein, sondern auch an den realen Gegebenheiten angepasst sein und vor allem ein tragfähiges Geschäftsmodell besitzen, das sowohl Nutzer als auch öffentliche Akteure überzeugt. Ein weiterer Blick auf langfristige Entwicklungsprogramme verdeutlicht die Problematik. So investierte USAID von 2014 bis 2022 fast 100 Millionen US-Dollar in das kenianische Programm Tusome, das Lesen in frühen Jahrgängen fördern sollte. Obwohl der Prozentsatz der Schüler, die nationale Lesestandards erreichten, leicht anstieg, blieb das Ergebnis trotz hoher Ausgaben moderat. Kritisch war, dass Tusome nicht von einem nachhaltigen Nachfrage- oder Finanzierungsmodell getragen wurde.
Die Unterstützung des Staates beschränkte sich größtenteils auf bereits bestehende Ressourcen, und wenn die externe Finanzierung wegfiel, ließen auch die Fortschritte merklich nach. Dies deutet darauf hin, dass allein Kosten-Nutzen-Betrachtungen nicht ausreichend sind. Die eigentliche Herausforderung liegt darin, Engagement und Wertschöpfung so zu gestalten, dass Produkte von Lehrern, Schülern und Regierungen gleichzeitig aktiv nachgefragt und genutzt werden. Engagement bedeutet dabei kulturelle Relevanz, Benutzerfreundlichkeit und nachhaltigen Mehrwert, ähnlich wie es Tech-Plattformen wie TikTok vorgemacht haben. Sie überzeugen nicht durch niedrige Kosten, sondern durch eine intuitive Nutzererfahrung und passgenaue Inhalte.
Edtech-Anbieter müssen dieses Prinzip ernst nehmen – statt Technologie von oben zu verordnen, sollte sie sich organisch verbreiten und eine echte Nachfrage bedienen. Als Beispiel zeigt sich, dass erfolgreiche Bildungsunternehmen auf dem globalen Markt vor allem dadurch wachsen, dass sie staatliche Einrichtungen als Hauptkunden gewinnen. Diese können mit zentralen Mitteln und einer breiten Reichweite skalieren. Nur so lässt sich die Chance nutzen, Produkte großflächig einzusetzen und gleichzeitig finanzielle Stabilität sicherzustellen. Gleichzeitig müssen Angebote so gestaltet sein, dass sie für Lehrer und Schüler tatsächlich hilfreich und nutzbringend sind, damit die Nutzung langfristig aufrechterhalten wird.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Notwendigkeit, innovative Finanzierungsmodelle für Afrikas Edtech-Ökosystem zu entwickeln. Eine Analogie bietet Gavi, die Vaccine Alliance, die es geschafft hat, Impfungen für über eine Milliarde Kinder durch koordinierte staatliche und private Finanzierung sicherzustellen. Ein vergleichbares Modell im Bildungsbereich könnte dazu beitragen, den ansonsten fragmentierten Markt zu bündeln, Investitionsrisiken zu senken und eine verlässliche Finanzierung zur Verfügung zu stellen, die an den tatsächlichen Bedarf angepasst ist. Auch wenn KI große Potenziale im Bildungsbereich bereithält, kann sie diese nur dann entfalten, wenn ihre Einführung in einen umfassenderen Rahmen eingebettet wird. Dazu gehören starke Partnerschaften mit Regierungen, realistische wirtschaftliche Modelle, der Ausbau von Infrastruktur und nicht zuletzt die Unterstützung von Bildungspersonal und Schülern.