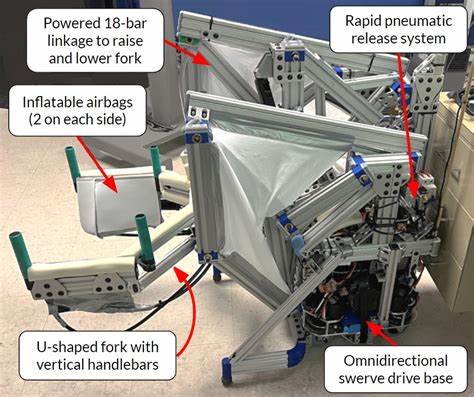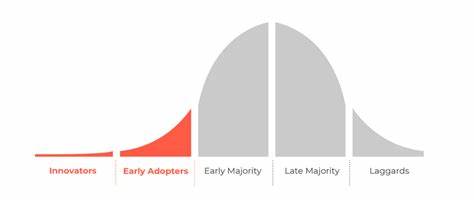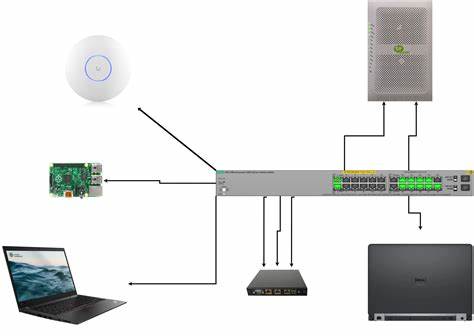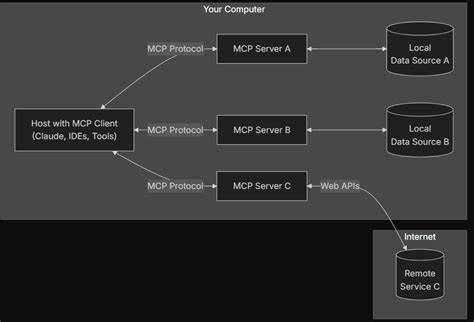In der heutigen politischen Diskussion stellt sich ein bemerkenswertes Paradox dar: Trotz wachsender sozialer und wirtschaftlicher Ungleichheit nehmen die Forderungen nach Umverteilung ab. Besonders auffällig ist, dass viele Menschen aus den unteren Einkommensschichten, die traditionell eher links gewählt haben, sich zunehmend der rechten politischen Seite zuwenden – und das, obwohl die ökonomischen Verhältnisse für sie oftmals prekär bleiben. Dieses Phänomen wirft die Frage auf, warum die Armen rechts wählen und ihre Forderungen nach mehr Gleichheit einstellen. Eine aktuelle Studie von Nicola Gennaioli und Guido Tabellini, zwei renommierten Ökonomen der Bocconi-Universität, liefert eine aufschlussreiche Antwort, die über die bloße Klassenfrage hinausgeht und einen neuen Blick auf die Rolle kultureller Identitäten und Werte eröffnet. Die Analyse zeigt, dass politische Konflikte nicht mehr primär anhand ökonomischer Verluste oder Gewinne ausgefochten werden, sondern an kulturellen Identitäten.
Historisch beruhte die politische Teilung vor allem auf ökonomischer Ungleichheit – Klassen und Besitz standen im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen. Doch in den letzten Jahrzehnten hat sich der Fokus zunehmend auf kulturelle Fragen verlagert: Themen wie Einwanderung, Religion, nationale Identität und „traditionelle Werte“ prägen die politische Debatte. Diese Fragen bewegen die Menschen emotional und symbolisch stärker als wirtschaftliche Argumente oder soziale Umverteilung. Dieser Wandel hat tiefgreifende Auswirkungen darauf, wie sich Wähler positionieren. Gennaioli und Tabellini zeigen, dass die Zugehörigkeit zu einer bestimmten kulturellen Identität zunehmend das politische Wahlverhalten bestimmt.
Es entstehen zwei sich gegenüberstehende Lager: auf der einen Seite die progressiven Kräfte, die für Multikulturalität, Offenheit und soziale Gleichheit eintreten; auf der anderen Seite diejenigen, die sich als Bewahrer lokaler, religiöser und traditioneller Werte verstehen. Interessanterweise können sich Menschen, die wirtschaftlich benachteiligt sind, durchaus der konservativen Gruppe zugehörig fühlen, wenn sie sich kulturell mit dieser stärker identifizieren und sie als bedroht wahrnehmen. Die Identität der Menschen wird in diesem Kontext als dynamisch und situativ verstanden. Wenn ökonomische Fragen dominieren, orientieren sich die Menschen stärker an Klassen- oder Einkommensgruppen. Doch sobald kulturelle Spannungen an Relevanz gewinnen, verschiebt sich die Zugehörigkeit zu kulturellen Kategorien.
Diese Wahl der Identität ist weder festgelegt noch zufällig, sondern eine bewusste Reaktion auf politische und gesellschaftliche Konflikte. Das Modell erklärt, dass Individuen sich zu jener Gruppe zählen, mit der sie sich am meisten verbunden fühlen und die sie als Gegner der „anderen“ Gruppe betrachten. Deshalb kann ein wirtschaftlich schlechter gestellter Arbeitnehmer sich eher als konservativer Traditionalist denn als Angehöriger der Arbeiterklasse verstehen. Der Einfluss von politischen Parteien in diesem Prozess ist nicht zu unterschätzen. Statt ökonomischer Programme investieren sie heute zunehmend in Identitätspropaganda und betonen kulturelle Gegensätze.
Wähler werden in „wir“ und „die anderen“ aufgeteilt – etwa Einheimische versus Einwanderer oder traditionelle Arbeiter versus progressive Elite. Diese Strategie führt zu einer verstärkten Politisierung kultureller Differenzen und macht politische Positionen extremer. Die Propaganda zielt nicht darauf ab, zu überzeugen, sondern zu radikalisieren, was zu einem immer schärferen ideologischen Konflikt führt, der von beiden Seiten emotional aufgeladen wird. Darüber hinaus zeigen die Forscher, dass die Wirkung der Identitätspolitik auch von historischen Bindungen der Parteien an bestimmte Bevölkerungsgruppen abhängt. Die konservativen Kräfte haben traditionell eine engere Beziehung zu religiösen und wohlhabenderen sozialen Gruppen, während die Linken eher mit Arbeiter- und progressiven Milieus verbunden sind.
Diese vertrauensbasierten Verbindungen beeinflussen die Wirksamkeit politischer Botschaften und verstärken bestehende politische Loyalitäten. Dadurch wird die Spaltung innerhalb der Gesellschaft zusätzlich vertieft und politische Polarisierung gefestigt. Die Ergebnisse basieren auf einer repräsentativen Umfrage unter 3.000 US-Bürgern, die eindrucksvoll belegen, dass die meisten Menschen sich aktuell eher kulturellen als ökonomischen Kategorien zuordnen. Wer sich selbst als „weiß, christlich, traditionell“ identifiziert, zeigt sich deutlich ablehnender gegenüber Einwanderung und weniger unterstützend gegenüber sozialer Umverteilung – unabhängig von seiner tatsächlichen Einkommenssituation.
Umgekehrt tendieren Personen, die sich als progressiv, säkular und global orientiert sehen, zu gegenteiligen politischen Einstellungen und Wahlentscheidungen. Ein praktisches Beispiel für das Phänomen lieferte der sogenannte „China-Schock“ in den USA. Der zunehmende wirtschaftliche Wettbewerb durch chinesische Importe hat US-Industriegebiete besonders stark getroffen. Während die betroffenen Regionen ökonomisch gelitten haben, haben sich dort die kulturell konservativen Meinungen verhärtet. Die Nachfrage nach Umverteilung ging zurück, während Forderungen nach restriktiveren Einwanderungspolitiken zunahmen.
Die tatsächlichen politischen Veränderungen liefen dabei bereits unabhängig von bestimmten politischen Figuren ab, etwa Donald Trump, und verdeutlichen eine tiefere gesellschaftliche Transformation. Über die USA hinaus erklärt das Modell auch Entwicklungen in Europa. Der Rückzug von traditionell sozialdemokratischen Parteien, das Erstarken rechter Parteien und die zunehmende Polarisierung lassen sich durch die Verschiebung von ökonomischen zu kulturellen Konflikten erklären. Linke Parteien, die weiterhin nur über Ungleichheit sprechen, verlieren immer mehr an Boden, da sie den kulturellen Identitätsaspekt vernachlässigen. Um wieder an Relevanz zu gewinnen, müssten sie neue Wege finden, beide Dimensionen, Ökonomie und Kultur, in ihrer Politik zu integrieren.