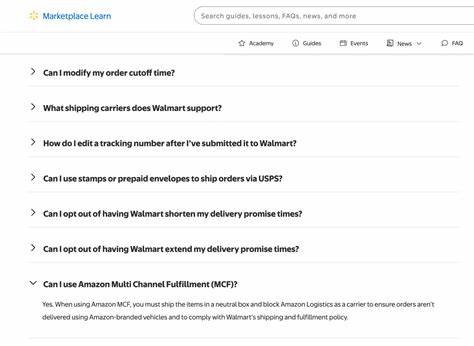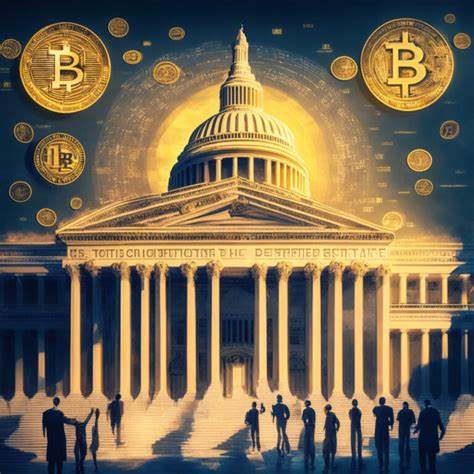Auf der kleinen Insel Jicarón, die etwa 55 Kilometer vor der Küste Panamas im Coiba-Nationalpark liegt, kam es zu einer verblüffenden Entdeckung in der Welt der Primatenforschung. Kameraaufnahmen zeigten männliche Kapuzineräffchen, die Babyaffen einer anderen Art mit sich trugen. Genauer gesagt entwendeten sie Jungtiere der bedrohten Subspezies der Mantelbrüllaffen, auch bekannt als Alouatta palliata coibensis. Dieses Verhalten fand wissenschaftliche Aufmerksamkeit wegen seiner Seltenheit und seiner unerklärlichen Natur. Die Entdeckung stammt von Zoë Goldsborough, einer Verhaltensökologin, die zunächst annahm, dass ein kleiner Affe auf dem Rücken eines Kapuziners ebenfalls ein Jungtier dieser Art sei.
Doch die unerwartete Färbung des Kindes ließ sie genauer hinschauen. Sie stellte fest, dass es sich um einen Babyaffen einer völlig anderen Spezies handelte – den Brüllaffen. Schnell wurde klar, dass es sich dabei nicht um einen Zufall handelt, denn weitere Aufnahmen zeigten mehrere männliche Kapuziner, die diese ungewöhnliche Praxis ausführten. In einem Zeitraum von etwa 15 Monaten dokumentierten Forscher mindestens elf Fälle, in denen subadulte und juvenile männliche Kapuzinerbabys der Brüllaffen entführten. Diese Handlungen wurden jedoch nicht von Fürsorgehandlungen begleitet.
Die Kapuziner spielten nicht mit den Kindes der Brüllaffen, sorgten nicht für sie und zeigten kaum Interaktionen, außer dem Tragen der Tiere auf dem Rücken. Die entführten Babys starben schließlich durch Verhungern, da sie keinen Zugang zu der Muttermilch hatten, die sie zum Überleben benötigen. Die Gründe für dieses merkwürdige Verhalten sind noch nicht abschließend geklärt. Die Wissenschaftler vermuten, dass die Abduktionshandlung eher eine Art kultureller Trend oder „Modeerscheinung“ unter den Kapuzinern ist als ein durch Evolution oder Überlebensdruck geprägtes Verhalten. Die Idee, dass es sich um ein sinnloses, möglicherweise durch Langeweile entstandenes Verhalten handelt, gewinnt zunehmend an Akzeptanz.
Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Tatsache, dass die Kapuziner auf Jicarón aufgrund der besonderen Bedingungen auf der Insel eine andere Lebensweise entwickelt haben als ihre Artgenossen auf dem Festland. Dort gibt es kaum natürliche Feinde, was dazu führt, dass die Affen ein größeres Gebiet für sich erkunden können und weniger in sozialen Gruppen zusammenbleiben müssen. Diese Freiheit eröffnet neue Verhaltensausprägungen, die im Festlandsystem nicht beobachtet werden. Die Beobachtung von Gelegenheiten und neuen kulturellen Verhaltensweisen ist nicht einzigartig für diese Insel. In anderen Primatengruppen zeigen sich ebenfalls kulturelle Innovationen, häufig initiiert von jüngeren Mitgliedern einer Gruppe, die noch nicht vollständig in die soziale Struktur eingebunden sind.
Ein bekanntes Beispiel hierfür ist das Kartoffelwaschen bei Makaken auf Japans Koshima-Insel, bei dem junge Tiere ein neues Verhalten entwickelten, das sich anschließend in der Gruppe verbreitete. In ähnlicher Weise könnte die Abduktion der Jungtiere der Brüllaffen auf Jicarón aus einer Art spielerischer Neugier und Experimentierfreude resultieren. Diese Interpretation wird auch dadurch gestützt, dass es vor allem jüngere, männliche Kapuziner sind, die das Verhalten zeigen. Sie befinden sich in einer Lebensphase voller Exploration, in der sie Grenzen austesten und neue Verhaltensweisen ausprobieren, ohne dass dies einen klaren Überlebensvorteil bringt. Die Forscher weisen auch auf das Konzept der „Überimitation“ hin, das man vor allem aus Studien mit menschlichen Kindern kennt.
Dabei werden Handlungen, die keinen direkten Zweck erfüllen, dennoch nachgeahmt, oftmals um sozial akzeptiert zu werden oder Gruppenzugehörigkeit zu signalisieren. Diese Tendenz könnte eine Rolle spielen, wenn andere männliche Kapuziner das Verhalten eines auffälligen Affen namens „Joker“ nachahmen, der mit einer markanten Mundnarbe hervorsticht und als einer der Hauptakteure bei den Entführungen gilt. Die ökologische Bedeutung dieser Entführungen ist nicht zu unterschätzen, da die Brüllaffen auf Jicarón eine gefährdete Subspezies darstellen. Mit nur einer Geburt alle zwei Jahre gehört ihre Population zu den sehr sensiblen, und der Verlust von Jungtieren, sei es durch natürliche oder ungewöhnliche Todesfälle, kann langfristige Konsequenzen für das Überleben der Art auf der Insel bedeuten. Gleichzeitig zeigt das Verhalten der Kapuziner eine weitere Facette der komplexen Interaktionen innerhalb eines Inselökosystems, die sich stark von denen auf dem Festland unterscheiden kann.
Der schmale Grat zwischen Neugier, sozialer Dynamik und ökologischem Einfluss lässt die Forscher nach tiefergehenden Antworten suchen. Aktuelle Kameraaufnahmen und das weiterhin laufende Monitoring sollen weitere Erkenntnisse bringen, insbesondere wie die Brüllaffen auf diese Angriffe reagieren und ob sie Strategien entwickeln, um ihre Neugeborenen besser zu schützen. Die Wissenschaftsgemeinschaft ist sich einig, dass das Phänomen ungewöhnlich und gleichzeitig faszinierend ist. Es stellt uns Menschen auch einen Spiegel vor das eigene Verhalten: Die Bereitschaft, scheinbar sinnlose Traditionen zu pflegen oder andere Spezies zu Schaden kommen zu lassen, ist nicht allein eine menschliche Eigenschaft. Solche kulturellen Praktiken können auch in der Tierwelt auftreten, vor allem in intelligenten und sozial komplexen Arten wie den Kapuzineräffchen.