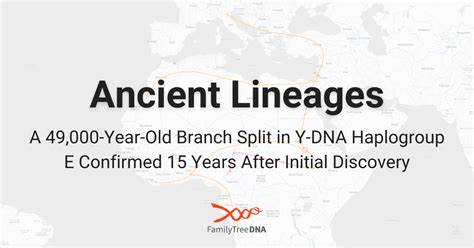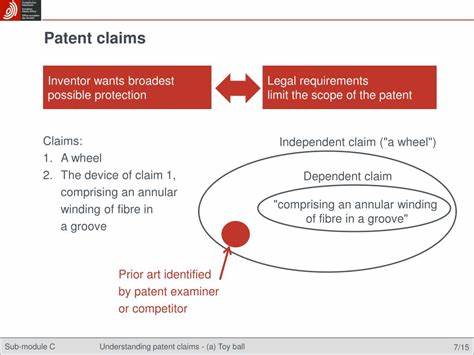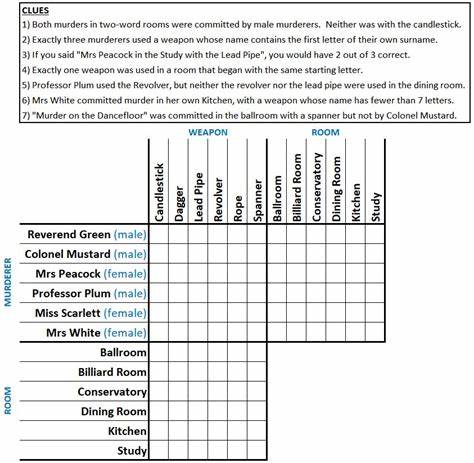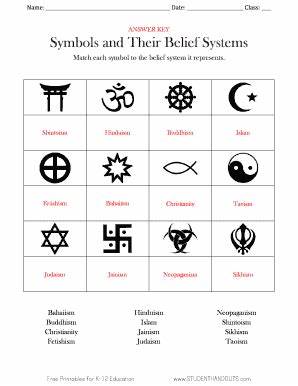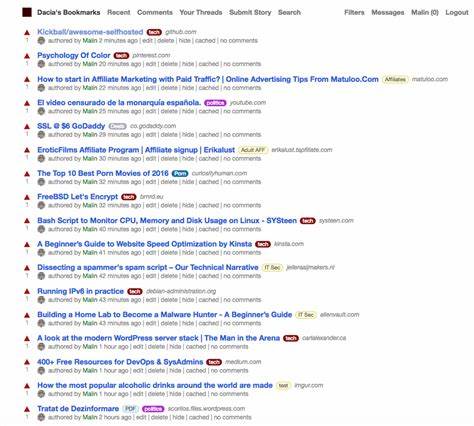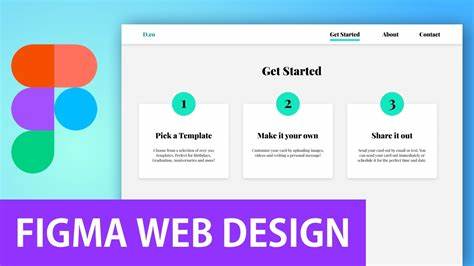Die Sahara, heute die größte heiße Wüste der Welt, war nicht immer eine lebensfeindliche Einöde. Während der sogenannten Afrikanischen Feuchtzeit, die vor etwa 14.500 bis 5.000 Jahren stattfand, erlebte die Sahara eine grüne Phase mit üppigen Savannenlandschaften, Flusssystemen und Seen. Diese klimatischen Bedingungen ermöglichten die Besiedlung durch Menschen, die Jagd, Fischfang und das Herden von Tieren betrieben.
Trotz der spannenden Archäologie und Paläoumweltforschung gab es bisher nur sehr wenig genetisches Wissen über die Bevölkerungsbewegungen und genetischen Hintergründe der Menschen, die in diesem Zeitraum in der Sahara lebten. Grund dafür war die herausfordernde Erhaltung von DNA in solchen klimatisch extremen Regionen. Erst vor kurzem konnten Wissenschaftler erstmals genomweite Daten aus rund 7.000 Jahre alten Skelettresten von zwei neolithischen Frauen aus dem Takarkori-Felsunterstand im zentralen Sahara-Gebiet in Südwestlibyen gewinnen. Diese neuen genetischen Daten lassen tief in die Geschichte der Bevölkerung Nordafrikas blicken.
Die Takarkori-Genomen repräsentieren eine bisher unbekannte und bisher undokumentierte nordafrikanische genetische Linie, die sich früh von den sub-saharischen Linien abspaltete – ungefähr parallel zur Divergenz der frühen modernen Menschen, die Afrika verließen. Diese isolierte Abstammungslinie blieb während der meiste Zeit ihrer Existenz genetisch weitgehend getrennt von sub-saharischen und auch nahöstlichen Populationen. Bemerkenswert ist, dass die Takarkori-Individuen enge Verwandtschaft mit 15.000 Jahre alten Jägern aus der Taforalt-Höhle in Marokko zeigen. Diese alte Verwandtschaft verbindet die beiden Populationen über eine Weite von mehreren tausend Kilometern hinweg und über große Zeiträume, was eine stabile Population in Nordafrika nahelegt, die vor der Afrikanischen Feuchtzeit existierte und sich wenig veränderte.
Ein weiterer wichtiger Befund betrifft den Einfluss genetischer Einflüsse aus sub-saharischen Afrikanern sowie Neanderthal-DNA. Die genetische Analyse zeigt nur sehr begrenzten Austausch der Takarkori-Bevölkerung mit sub-saharischen Linien während der Grünen Sahara. Dies steht im Einklang mit der Ansicht, dass der Sahara auch während feuchterer Phasen eine bedeutende natürliche Barriere für genetischen Fluss bildete. Zugleich zeigt die Takarkori-DNA deutlich weniger Neandertaler-Admixtur als jene von heutigen Menschen außerhalb Afrikas oder glücksverwandten Populationen im Nahen Osten, aber mehr als in heutigen sub-saharischen Gruppen, was auf eine sehr spezifische historische Abstammung verweist, die früh mit außereuropäischen Populationen verbunden war, jedoch überwiegend in Afrika verblieb. Die Erkenntnisse liefern auch neue Perspektiven zum Ursprung der Pastoralgesellschaften in der Sahara und Nordafrika.
Archäologische Funde deuten die Einführung der Viehzucht im zentralen Sahara-Gebiet vor etwa 8.300 Jahren an, wobei sich die Viehhirten rasch in die Region ausbreiteten. Die genetischen Resultate deuten darauf hin, dass die Einführung pastoraler Lebensweisen vor allem durch kulturelle Diffusion erfolgte und weniger durch große Wanderungsbewegungen von Menschen aus dem Nahen Osten. Die Takarkori-Population zeigt nur eine geringe Einmischung von nahöstlicher Herkunft, was bedeutet, dass sich die lokale Bevölkerung wohl vorhandenen kulturellen Innovationen annahm, anstatt durch massive Bevölkerungsbewegungen verdrängt zu werden. Die kulturellen und ökologischen Entwicklungen im zentralen Sahara-Gebiet während dieser Zeit waren komplex.
Das Felsunterstand Takarkori liegt in den Tadrart Acacus-Bergen, einem Gebiet, das zahlreiche Einblicke in die Lebensweise der frühen Menschen am Rande der Wüste gibt. Die Artefakte und Befunde zeigen, dass die Menschen sowohl jagten als auch früh domestizierte Tiere hielten. Die neolithischen Gesellschaften beschrieben in diesem Kontext verfolgten einen Lebensstil der Transhumanz, mit saisonalen Wanderungen ihrer Herden über weite Strecken, und deren materiell-kulturelles Inventar spiegelte eine Mischung aus lokalen Traditionen und kulturellen Innovationen. In diesem Zusammenhang veranschaulichen die genetischen Daten, wie kultureller Wandel ohne erhebliche Bevölkerungsbewegungen ablaufen kann. Auf einer genetischen Ebene verdeutlichen die Daten auch die komplexe Beziehung zwischen urzeitlichen Menschen in Nordafrika und anderen Populationen auf dem afrikanischen Kontinent.
Die Takarkori-Genome gehören einer genetischen Linie an, die sich wahrscheinlich schon im späten Pleistozän, vor mehr als 60.000 Jahren, von anderen Linien getrennt hat und wahrscheinlich weit verbreitet in Nordafrika war. Die Nähe zu den Taforalt-Jägern des späten Pleistozäns zeigt eine bemerkenswerte genetische Kontinuität in Nordafrika über einen Zeitraum von mindestens 8.000 Jahren, trotz bedeutender klimatischer und kultureller Veränderungen. Diese genetische Isolierung und Kontinuität stellt einen wichtigen Kontrast zu den genetischen Muster dar, die an anderen Orten Afrikas und im Nahen Osten beobachtet wurden.
Zum Beispiel weisen Levantinische Neolithiker und europäische Gruppen, die aus Afrika ausgewandert sind, deutlich mehr Neandertaler-DNA auf als die Takarkori-Individuen. Dies unterstützt die Hypothese, dass die Vorfahren der Takarkori-Bevölkerung eng mit dem Ursprung des modernen Menschen in Afrika verknüpft sind und eine eigene Linie darstellen, die sich außerhalb Afrikas anders entwickelte. Auch die historische Rolle der Grünen Sahara als Verbreitungsgebiet von Technologien, wie die Viehzucht, wird durch diese Forschung neu bewertet. Während früher angenommen wurde, frühere Neolithika seien eng mit Migrationen von Bevölkerungen aus dem Nahen Osten verbunden, zeigen die neuen genetischen Ergebnisse, dass mindestens in Zentrale Sahara und Nordafrika oft kultureller Austausch im Vordergrund stand. Die genetische Datenlage ermöglicht es, die Ausbreitung von Viehhaltung, Keramik und anderen kulturellen Elementen unabhängig von großangelegten Bevölkerungsverschiebungen zu verstehen.
Die takarkorischen Frauen, deren genetische Spuren analysiert wurden, geben zudem Hinweise zur Populationsgröße und sozialen Struktur. Es lässt sich rekonstruieren, dass es keine ausgeprägten Hinweise auf engen Inzest gab; die Populationsgröße wird auf mehrere tausend geschätzt. Somit waren die Menschen Teil einer stabilen, aber isolierten nordafrikanischen Gesellschaft, die in einer komplexen Umwelt lebte. Diese Erkenntnisse haben auch bedeutende Konsequenzen für das Verständnis der heutigen genetischen Vielfalt in Nord- und Westafrika. Zum Beispiel weisen heutige Fulani-Völker aus der Sahelzone genetische Affinitäten zur Takarkori-Linie auf, was auf eine historische Verbindung und südliche Ausbreitung dieser frühen nordafrikanischen Abstammung hindeutet.
Die genetischen Spuren dieser uralten Populationen sind somit noch bis heute in den Genpools vieler afrikanischer Bevölkerungen nachweisbar. Zusammenfassend revolutionieren die Daten aus der Grünen Sahara unser Verständnis der menschlichen Besiedlung Nordafrikas, der Dynamik von Migration und kulturellem Wandel im Neolithikum sowie der im afrikanischen Kontinent verbreiteten genetischen Abstammungslinien. Oft nehmen wir an, dass große kulturelle Veränderungen auch stets mit starken demografischen Verschiebungen einhergehen, doch in der Sahara zeigt sich eine subtile Verknüpfung von kultureller Diffusion mit genetischer Isolation. Die Forschungen verdeutlichen den Wert von antiker DNA, die aus schwierig zu analysierenden Wüstenregionen gewonnen werden kann. Künftig könnten weitere Funde und Genomsequenzierungen weitere Details zur menschlichen Geschichte, den Wanderungen und den Wechselwirkungen zwischen frühen Bevölkerungen liefern und helfen, Fragezeichen über den Ursprung der Pastoralgesellschaften, die Rolle des Sahara-Grüns und den Einfluss von klimatischen Veränderungen auf die menschliche Entwicklung zu klären.
Diese Arbeit markiert daher einen wichtigen Meilenstein in der Erforschung der afrikanischen Vorgeschichte und umfasst eine starke Kooperation internationaler Forschungsinstitutionen, die molekulargenetische, archäologische und paläoklimatische Daten zusammenführen, um ein ganzheitliches Bild der frühen Menschheitsgeschichte zu schaffen.