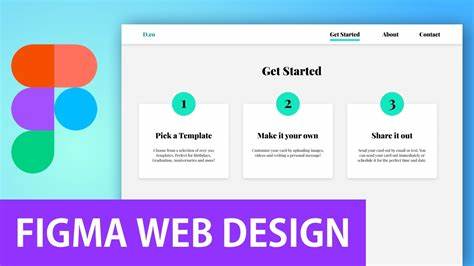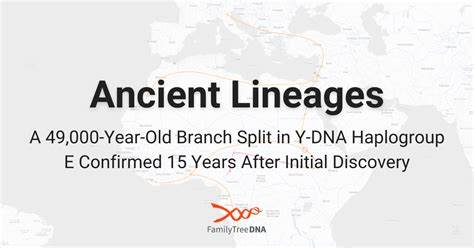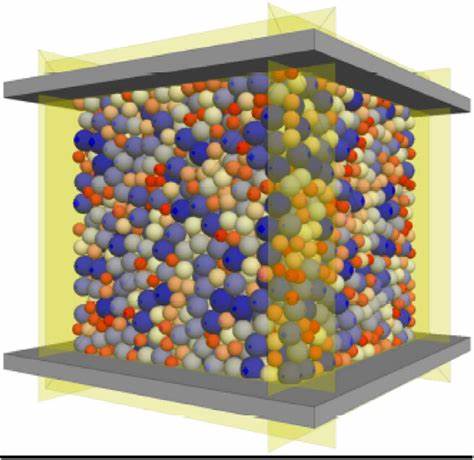Die moderne Webentwicklung steht vor der ständigen Herausforderung, innovative Technologien zu nutzen, um Effizienz und Kreativität zu steigern, gleichzeitig aber auch die Anforderungen an Barrierefreiheit, Datenschutz und Nutzerfreundlichkeit zu erfüllen. Mit der Einführung von Figma Sites als Teil des Produktportfolios von Figma, einem der führenden Design-Tools, verspricht das Unternehmen, den Weg vom Design zum Live-Produkt radikal zu vereinfachen. Doch hinter diesen verheißungsvollen Versprechen verstecken sich erhebliche Probleme, die insbesondere für Unternehmen und Designer ein Warnsignal darstellen sollten. Figma Sites ist ein neues Feature, das es erlaubt, Designprojekte aus Figma direkt als Websites zu veröffentlichen. Dieses Konzept ähnelt auf den ersten Blick Tools wie Dreamweaver aus den 1990er Jahren, allerdings mit moderneren Features wie responsivem Design oder interaktiven Elementen.
Trotz dieser scheinbaren Innovation wird schnell ersichtlich, dass das Tool in puncto Barrierefreiheit und Codequalität massive Defizite aufweist. Das hat weitreichende Konsequenzen: Websites, die mit Figma Sites erstellt werden, können grundlegende Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) nicht erfüllen, eröffnen rechtliche Risiken und schaden letztlich dem Ruf der Betreiber. Die WCAG sind international anerkannte Standards, die dafür sorgen, dass Webinhalte für alle Nutzer zugänglich sind – auch für Menschen mit Behinderungen. Missachtungen dieser Richtlinien führen nicht nur zu Ausschluss, sondern auch zu potenziellen Klagen, gerade im europäischen Konformitätsrahmen wie der DSGVO und weiteren Gesetzen. Die Automatisierten Tests, die an den von Figma bereitgestellten Beispielseiten durchgeführt wurden, offenbarten mehrere hundert Verstöße gegen die WCAG.
Diese reichen von fehlenden Alternativtexten bei Bildern, mangelnder Farbkontrastierung, fehlenden semantischen Elementen wie Überschriften und Navigationsmarken bis hin zu nicht interaktiven Elementen, die dennoch im Tastaturnavigationsfluss enthalten sind. Die jeweilige zugrundeliegende HTML-Struktur ist ein weiteres Problem: Trotz moderner Möglichkeiten generiert Figma Sites überwiegend „div-Suppen“ – also eine Verschachtelung zahlloser <div>-Tags ohne sinnvolle Semantik. Dies erschwert nicht nur die Bedienbarkeit mit Screenreadern, sondern auch die Wartbarkeit und Suchmaschinenoptimierung der Websites. Fehlen beispielsweise Links oder werden Interaktionen nur über Event-Handler ohne semantische Markierungen realisiert, dann leidet die Benutzererfahrung erheblich. Neben der Barrierefreiheit und der Codequalität zeigt sich eine weitere Schwäche darin, dass Figma Sites den Fokus auf visuelle Effekte wie Parallax oder Animationen legt, anstatt echte Interaktivität zu gewährleisten.
Ohne native Tags wie <button> oder <a> entsteht ein gravierender Widerspruch zu den grundsätzlichen Prinzipien des Webs, die auf semantisch korrektem, zugänglichem und funktionalem Code basieren. Dies wirkt sich auf Nutzer aus, die auf assistive Technologien angewiesen sind, und gleichzeitig auf die Auffindbarkeit der Seite durch Suchmaschinen. In mehreren Rückmeldungen aus der Webentwickler- und Accessibility-Community wird deutlich, dass Figma Sites als Produkt weit hinter den Erwartungen zurückbleibt. Selbst während der Beta-Phase, in der vermeintlich bewusst Kompromisse akzeptiert werden, sind die vorliegenden Mängel so fundamental, dass sie nicht hinnehmbar sind. Die eingesetzten Tools wie Axe DevTools, ARC Toolkit oder Equal Access Accessibility Checker liefern teils hunderte Fehler, deren manuelle Korrektur den Produktionsaufwand massiv erhöhen würde – ein Widerspruch zum Versprechen der Effizienzgewinne.
Die Kritik an Figma Sites ist dabei nicht nur technischer Natur. Der Launch des Produkts wirkt vielfach überstürzt, als wäre das Hauptziel weniger, Nutzer mit einem ausgereiften Werkzeug zu versorgen, sondern vielmehr, den Investoren bei einer wichtigen Konferenz einen aufmerksamkeitsstarken Tastaturanschlag zu bieten. Dieses Vorgehen wird als typisches Beispiel für das sogenannte „Konferenz-getriebene“ Produktmanagement gesehen, bei dem Features unfertig veröffentlicht werden, um Marketingziele zu erreichen, statt echten Mehrwert zu liefern. Aus Sicht der Webentwicklung bedeutet das im Ergebnis, dass der Einsatz von Figma Sites in seiner aktuellen Form kaum vertretbar ist, wenn das Ziel professionelle und zugängliche Webseiten sind. Die Veröffentlichung von Designs in einem ungeprüften und unzugänglichen HTML-Output bringt nicht nur Image-Schäden und mögliche Rechtsfolgen mit sich, sondern schließt auch potenzielle Kunden aus und behindert die Nutzung durch Menschen mit Beeinträchtigung – eine Entwicklung, die dem inklusiven Anspruch des Webs diametral entgegensteht.
Zwar hat Figma nach erheblicher Kritik erste Schritte unternommen, um semantischere HTML-Tags zu verwenden und einige Zugänglichkeitsmängel zu beheben, doch die Maßnahmen bleiben bislang unzureichend. Einige Features wie verlässliche Link-Unterstützung oder umfassende ARIA-Rollen und -Attribute fehlen weiterhin oder sind nur eingeschränkt umsetzbar. Die Versprechen zur Barrierefreiheit sind derzeit eher ein vage formuliertes Ziel als tatsächlich umgesetzter Standard. Darüber hinaus überrascht es, dass Figma Sites trotz bekannter Probleme und öffentlich dokumentierter Schwachstellen weiterhin als praktikables Werkzeug angepriesen wird. Das Risiko, dass minderwertiger Code in die Codebasis zahlreicher Websites einfließt und so langfristig die Qualität des Webs beeinträchtigt, darf nicht unterschätzt werden.
Eine verantwortungsvolle Webentwicklung erfordert, dass automatisierte Tools, Designprogramme und Publishing-Plattformen über technische Prüfungen verfügen, die auch grundlegende Standards konsequent durchsetzen, bevor eine Website live geschaltet wird. Interessant ist auch die Perspektive, dass Figma Sites den Weg für die sogenannte „De-Skilling“-Debatte ebnet. Indem das Tool komplexe Codierungsaufgaben automatisiert und vermeintlich einfache Lösungen bietet, könnte dies den Bedarf an spezialisierten Webentwicklern und Accessibility-Experten verringern. Allerdings sollte diese Automatisierung nicht zu Lasten der Code-Qualität oder der Nutzerfreundlichkeit gehen. Vielmehr ist es wichtig, dass solche Tools als unterstützende Hilfsmittel dienen, deren Output von Experten geprüft und bei Bedarf vervollständigt wird.
Für Designer und Unternehmen, die auf der Suche nach schnellen Lösungen sind, mag Figma Sites verlockend erscheinen. Dennoch ist Vorsicht geboten. Wer seine Webauftritte professionell betreiben möchte und dabei die gesetzlichen sowie ethischen Anforderungen erfüllen will, sollte die erzeugten Websites umfassend überprüfen oder Alternativen in Betracht ziehen. Klassische Entwicklungswege mit sauberem, semantischem HTML und entsprechender Accessibility-Fokussierung bleiben unverzichtbar. Die Kritik an Figma Sites hat auch gezeigt, dass automatisierte Tests nur einen Teil möglicher Probleme erfassen.
Viele Barrieren entstehen durch Designentscheidungen, Code-Strukturen oder fehlende semantische Konzepte, die automatischen Tools nicht auf den ersten Blick ins Auge fallen. Daher bleibt insbesondere die menschliche Expertise in der Webentwicklung unerlässlich – gerade auch zum Thema Barrierefreiheit. Abschließend bleibt festzuhalten, dass Figma Sites derzeit keine geeignete Plattform ist, um direkt und ohne umfassende Korrekturen produktionsfertige Websites zu veröffentlichen. Die Versprechen von schneller Integration und vollautomatischer Webseite-Erstellung werden dem tatsächlichen Entwicklungsaufwand und den Anforderungen an Zugänglichkeit und Qualität nicht gerecht. Wer Webdesign professionell und verantwortungsvoll betreiben möchte, sollte diese Tools mit kritischem Blick betrachten und auf etablierte Methoden sowie qualitätsgeprüfte Workflows setzen.