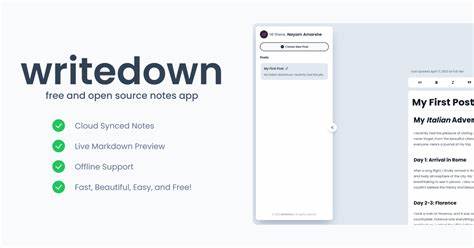Die Musikindustrie hat sich in den letzten Jahren radikal verändert. Streaming-Plattformen wie Spotify, Apple Music und Tidal sind heute die dominanten Vertriebswege für Musik und bieten Künstlern theoretisch die Möglichkeit, eine globale Hörerschaft zu erreichen. Doch mit diesen Chancen kommen auch neue Risiken und betriebswirtschaftliche Grauzonen. Ein besonders bemerkenswerter Fall aus den USA hat im Jahr 2024 für Schlagzeilen gesorgt: Michael Smith, ein Mann mit Verbindungen zur Musik- und Gesundheitsbranche, wurde wegen eines milliardenschweren Betrugs angeklagt, bei dem künstliche Intelligenz (KI) und automatisierte Streaming-Bots zum Einsatz kamen, um künstlich Streams zu generieren und dadurch Millionen an Tantiemen abzuzocken.Michael Smith und sein Partner Jonathan Hay hatten Anfang der 2010er Jahre begonnen, gemeinsam Musik zu produzieren, insbesondere im Jazz-Genre.
Dabei schien ihr erstes Album nicht den erhofften Durchbruch zu schaffen. Doch bald darauf gelang mit der Deluxe-Version des Albums ein unerwarteter Aufstieg an die Spitze der Billboard-Charts – eine ungewöhnliche Entwicklung, die erste Zweifel aufkommen ließ. Denn trotz der gigantischen Streamingzahlen fehlte eine wesentliche Komponente: echte Fans und echte Nachfrage. Die Streamingzahlen waren verdächtig hoch, die Zuhörerschaft geografisch ungewöhnlich verteilt – konzentriert in Gegenden wie Vietnam, und ohne die übliche Online-Präsenz oder Community-Reaktionen.Diese merkwürdigen Umstände führten schließlich dazu, dass die Musikvertriebe Alarm schlugen.
Distributoren begannen, die Werke von Smith und Hay wegen verdächtiger Streamingmuster zu markieren und teilweise sogar aus den Plattformen zu entfernen. Smith gab zunächst an, es handele sich um Fehler oder Probleme mit der Rechteverwaltung. Später offenbarte sich jedoch ein viel komplexeres und betrügerisches System dahinter: Smith hatte eine Armee von Bots und gefälschten Konten geschaffen, die rund um die Uhr KI-generierte Songs abspielen sollten, um durch die Masse an Streams hohe Tantiemenzahlungen zu erhalten.Die Verwendung von KI-Musikgeneratoren ist an sich nicht illegal. Plattformen wie Boomy bieten bereits seit einigen Jahren die Möglichkeit, Songs mithilfe künstlicher Intelligenz zu erstellen.
Doch Smith ging einen Schritt weiter: Er setzte automatisierte Programme ein, um Tausende von Konten mit diesem „Instant Music“ zu speisen und die Songs permanent zu streamen – ein klarer Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen der Streaming-Anbieter. So entstand eine künstliche Hörerzahl von über einer Milliarde Streams, ohne dass echte Menschen die Musik hörten oder davon erzählten.Der Fall Smith ist eine alarmierende Illustration für die Herausforderungen, denen die Musikindustrie im digitalen Zeitalter gegenübersteht. Millionen von Songs werden täglich auf Streaming-Plattformen hochgeladen, immer mehr davon mithilfe von KI-generierten Inhalten. Die rechtliche Lage ist unklar, da das Erstellen von Musik per KI als kreative Leistung gilt, solange keine urheberrechtlich geschützten Vorlagen illegal verwendet werden.
Doch der Versand von künstlichen Streams, um systematisch Musik zu monetarisieren, bewegt sich in Grauzonen und wird zunehmend strafrechtlich verfolgt.Internationale Studien legen nahe, dass mehrere Prozent aller Streaming-Vorgänge betrügerisch sind – manche Experten schätzen die Dunkelziffer sogar auf rund zehn Prozent oder höher. Dabei machte der Fall Smith klar, wie lukrativ solch ein Betrug sein kann: Über zehn Millionen Dollar an Tantiemen sollen demnach durch die Kombination von KI-Musik und Bot-Streaming in weniger als einem Jahrzehnt erschlichen worden sein. Während die großen Plattformen wie Spotify behaupten, ihre Systeme hätten den Großteil der betrügerischen Streams erkannt und blockiert, bleibt die Herausforderung bestehen, Betrug völlig auszuschließen und ein faires System zur Künstlervergütung zu garantieren.Ein weiterer Aspekt, der im Smith-Fall hervorsticht, ist die menschliche Komponente.
Jonathan Hay, Smiths ehemaliger Partner, beschreibt in Interviews einen lange währenden Vertrauensbruch. Anfangs hatten die beiden Männer noch gemeinsame Ziele, die Musikindustrie durch Qualität und Investition zu erobern. Doch divergierende Wege, finanzielle Unregelmäßigkeiten und die moralische Last der Streaming-Manipulation führten zu einem Zerwürfnis. Hay selbst versuchte wiederholt, auf Unregelmäßigkeiten aufmerksam zu machen, führte Gespräche mit der Polizei und sogar mit der FBI, blieb jedoch über Jahre weitgehend ohne Unterstützung.Die Verhaftung Smiths im September 2024 markiert nun einen Wendepunkt.
Während er alle Vorwürfe bestreitet und sich auf seinen Rechtsweg vorbereitet, wirft der Fall grundsätzliche Fragen auf: Wie können Musikstreaming-Services ihre Ökosysteme vor Missbrauch schützen? Welche Rolle spielen KI-Technologien in der Zukunft der Musikproduktion und des Konsums? Und wie können echte Künstler vor Wettbewerb durch maschinell erzeugte, aber künstlich gepushte Inhalte geschützt werden?Diese Fragen sind nicht nur für die USA relevant, sondern für die globale Musikszene. Mit der Verbreitung von KI-Music-Generatoren wird die Barriere für die Produktion neuer Songs immer niedriger. Gleichzeitig eröffnen sich neue Möglichkeiten für Kreativität und Innovation. Doch die Kehrseite zeigt sich in Form von Betrugsversuchen, die gesamte Branchen untergraben können, die ohnehin schon mit der Verteilung von Gewinnen zwischen Künstlern, Labels und Plattformen kämpfen.Der Fall Smith ist somit ein warnendes Beispiel, wie technologische Fortschritte missbraucht werden können, um geltende Systeme auszutricksen.
Es zeigt aber auch, dass gegen diese Entwicklungen verstärkt regulatorische Antworten, ausgefeilte technische Erkennungsmethoden und eine verstärkte Sensibilisierung der Akteure notwendig sind. Für Musiker, Produzenten und Hörer bleibt die Herausforderung, Qualität, Authentizität und Kreativität von der Masse an generiertem Inhalt unterscheiden zu können.Die großen Streaming-Dienste arbeiten bereits an KI-basierten Algorithmen, um Streaming-Fraud zu erkennen und zu verhindern. Doch Experten wie Morgan Hayduk von der Streaming-Fraud-Erkennungsfirma Beatdapp warnen, dass diese „KI gegen KI“-Kämpfe fortwährend geführt werden müssen. Solange es lukrative Mittel gibt, die eigenen Songs durch betrügerische Streams zu pushen, wird es immer wieder neue Versuche geben, die Systeme auszutricksen.
Im Zentrum dieses komplexen Szenarios steht die Frage nach der Zukunft des Musikmarktes im digitalen Zeitalter. Künstliche Intelligenz eröffnet neue Wege in der Musikkreation, macht Kleidungsstücke der Menschlichkeit wie Kreativität verfremdet und algorithmisch reproduzierbar. Der Fall Michael Smith zeigt, dass die Grenzen zwischen künstlerischem Schaffen und betrügerischem Verhalten zunehmend verschwimmen und neue ethische, rechtliche und wirtschaftliche Diskussionen erforderlich machen.Die Geschichte vom Mann, der eine Milliarde Streams generierte und doch keine echten Fans vorweisen kann, ist nicht nur eine kuriose Anekdote, sondern ein Spiegelbild der aktuellen Herausforderungen in der Musikbranche. Es bleibt abzuwarten, wie sich Regierungen, Plattformen und die Musikgemeinschaft selbst diesen Herausforderungen stellen werden – denn die Musik, so vielfältig und lebendig sie heute ist, steht vor einem ihrer größten Umbrüche aller Zeiten.
Die Zeit der traditionellen Musikindustrie ist vorbei, und das Spiel mit KI und Streaming-Bots hat die Regeln grundlegend verändert. Nur wer daran angepasst wird, kann in dieser neuen Ära überleben.



![KumoRFM: A Foundation Model for In-Context Learning on Relational Data [pdf]](/images/DCB3D738-177C-4806-9DFE-A9A6E31F1201)