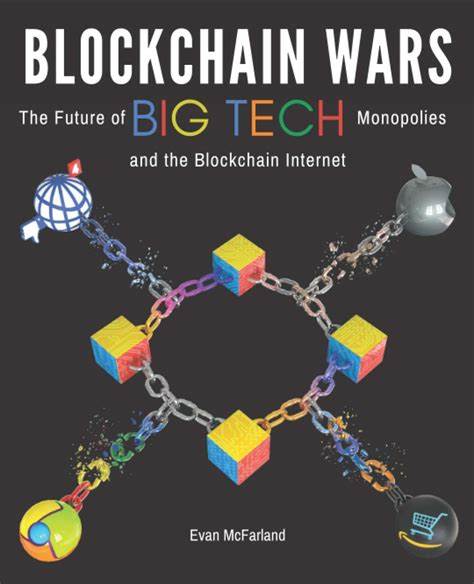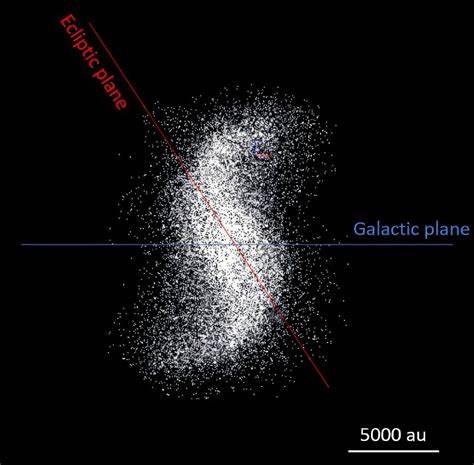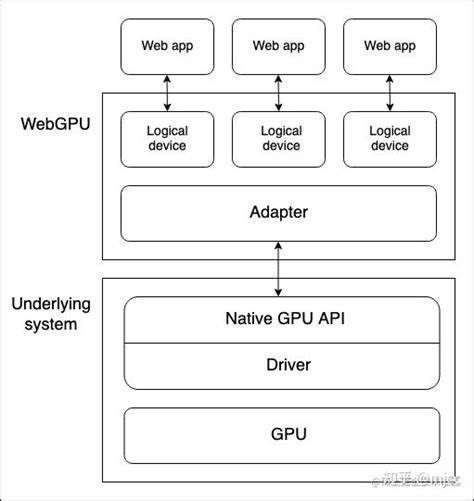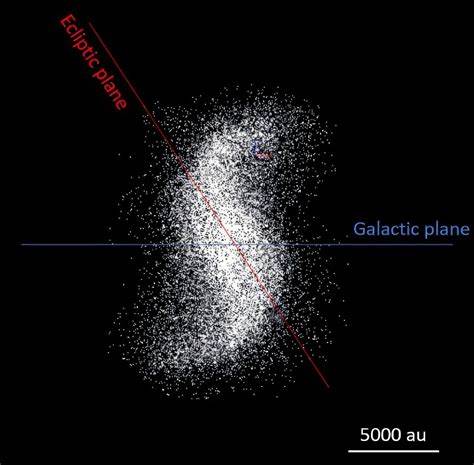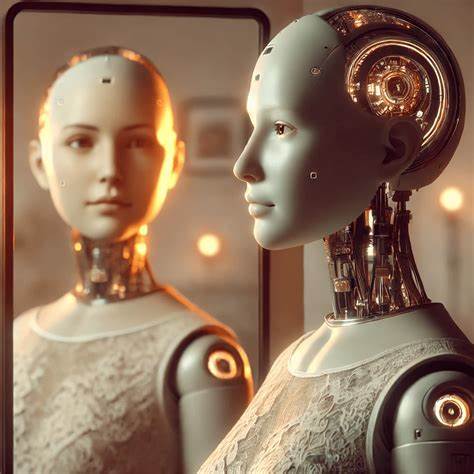Das Internet war ursprünglich als ein offenes, freies und vielfältiges Medium gedacht, das den Zugang zu Wissen und Kommunikation für alle erleichtern sollte. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich das Web jedoch stark verändert. Große Technologieunternehmen wie Google, Facebook, Amazon und Apple dominieren nun den digitalen Raum. Anstatt die Nutzererfahrung zu verbessern, haben diese Monopole das Internetgefühl vieler Menschen negativ beeinflusst. Dieser Wandel ist keine bloße Einbildung oder nostalgische Erinnerung an bessere Zeiten, sondern eine erkennbare Entwicklung, die zunehmend kritisiert wird.
Die Verschlechterung des Internets lässt sich auf verschiedene Aspekte zurückführen, die stark mit der Marktbeherrschung großer Tech-Konzerne zusammenhängen. Eines der zentralen Probleme ist die sogenannte „Ensh-ttifizierung“, ein Begriff, geprägt vom Aktivisten und Autor Cory Doctorow. Er beschreibt die Tendenz großer Firmen, Produkte und Plattformen absichtlich unattraktiv zu machen, um an anderer Stelle mehr Profit zu erzielen. Dabei zählt nicht der Nutzer als Kunde, sondern diese werden häufig selbst zur Ware degradiert, indem ihre Daten ausgebeutet und Werbung übermäßig eingeblendet wird. Google, Facebook und Amazon zeigen seit Jahren ein ähnliches Verhalten.
Da sie eine marktbeherrschende Stellung innehaben, fehlt es ihnen an Anreiz, ihre Plattformen benutzerfreundlicher zu gestalten. Stattdessen benutzen sie ihre dominante Position, um Konkurrenz zu neutralisieren. Beispiele gibt es genug: Facebook erwarb Instagram, um es entweder in seinem Wachstum zu kontrollieren oder im schlimmsten Fall so zu verändern, dass es der profitablen Werbestrategie besser dienen konnte. Gleichzeitig wird dadurch Innovation unterdrückt und das Nutzererlebnis leidet. Auch bei der Suche im Internet ist die Situation problematisch.
Nutzer, die früher mit wenigen Klicks an hochwertige Informationen gelangten, müssen heute oft lange scrollen. Sie werden mit Anzeigen, Spam-Webseiten und künstlich generierten Inhalten konfrontiert, die tief in den Suchergebnissen versteckt sind. Die Qualität und Relevanz der Suchergebnisse hat abgenommen, was die Effizienz der digitalen Informationssuche reduziert. Diese Entwicklung lässt sich deutlich auf den kommerziellen Druck und die Marktmacht der Suchmaschinenanbieter zurückführen. Das Problem geht jedoch über reine Nutzerunzufriedenheit hinaus: Die wirtschaftliche Machtkonzentration bei wenigen Unternehmen hat erhebliche Auswirkungen auf die Innovation und Vielfalt im Internet.
Startups und kleinere Unternehmen haben es immer schwerer, Fuß zu fassen. Oft werden sie entweder übernommen oder von den dominierenden Plattformen durch geschickte Geschäftspraktiken oder exklusive Vereinbarungen aus dem Markt gedrängt. Dieses Verhalten hebt den Wettbewerb auf und führt zu einem stagnierenden digitalen Ökosystem. Die Auswirkungen auf Datenschutz und Nutzerdaten sind ebenfalls gravierend. Große Tech-Konzerne sammeln massenhaft persönliche Daten, die sie für gezielte Werbung und andere Geschäftsmodelle nutzen.
Da sie kaum Konkurrenz fürchten müssen, gibt es wenig Druck, den Schutz der Nutzerdaten zu verbessern oder transparentere Praktiken einzuführen. Das führt zu einem Verlust an Privatsphäre und einer zunehmenden Überwachung der Internetnutzer. Doch der Zustand des Internets ist kein unabänderliches Schicksal. Es gibt eine wachsende Bewegung, die für eine Regulierung der Tech-Monopole plädiert. Insbesondere die Durchsetzung von Antitrust-Gesetzen könnte den Wettbewerb wiederbeleben und Machtkonzentrationen reduzieren.
Dieses Thema erfährt seit einigen Jahren eine Renaissance, auch wenn die juristischen Prozesse oft langwierig und komplex sind. Trotzdem gewinnen diese Initiativen, wie etwa gegen Google und Facebook, zunehmend an Bedeutung und politischen Rückhalt, da parteiübergreifend Kritik an der Vormachtstellung der Tech-Riesen geäußert wird. Eine weitere Lösungsoption liegt in der rechtlichen Öffnung von Geschäftsmodellen. Ein Beispiel hierfür ist die „OG Instagram“-App, entwickelt von einer Gruppe Jugendlicher, die eine werbefreie, datenschutzfreundliche Version der Plattform bereitstellte. Obwohl sie beliebt wurde, wurde sie aufgrund von Druck seitens der etablierten Unternehmen schnell wieder vom Markt genommen.
Dies zeigt, wie straff und nahezu unangreifbar das Geschäftsmodell der großen Konzerne derzeit geschützt ist, oft auch durch Gesetze, die eigentlich nicht explizit den Interessen der Tech-Giganten dienen sollten. Auf internationaler Ebene spielt die Rolle der Handelspolitik und Zollmaßnahmen eine überraschende Rolle. Die USA nutzen immer wieder die Drohung mit Zöllen, um andere Länder dazu zu bewegen, amerikanische Technologieunternehmen zu bevorzugen – auf Kosten von Nutzerrechten und Wettbewerb im Internet. Doch an diesem Punkt könnte ein Umdenken stattfinden, denn wenn Zölle dauerhaft bestehen bleiben, könnten andere Nationen versuchen, unabhängige und offenere Internetstrukturen zu fördern, um der Dominanz einzelner Unternehmen zu entgehen. Die Zukunft des Internets hängt entscheidend davon ab, ob Gesellschaft und Politik es schaffen, den Einfluss und die Marktbeherrschung der großen Tech-Firmen zu begrenzen.