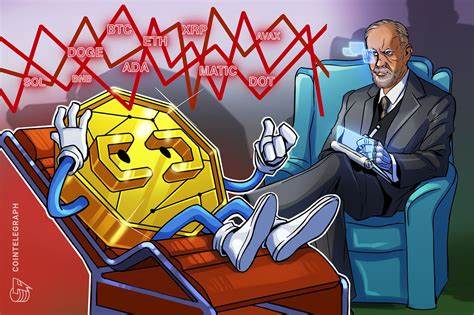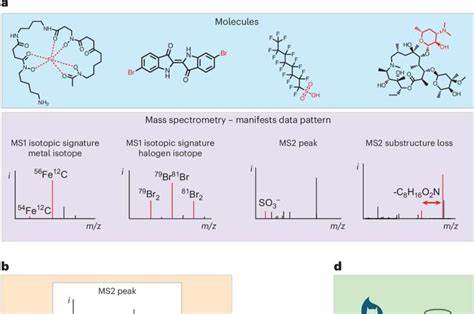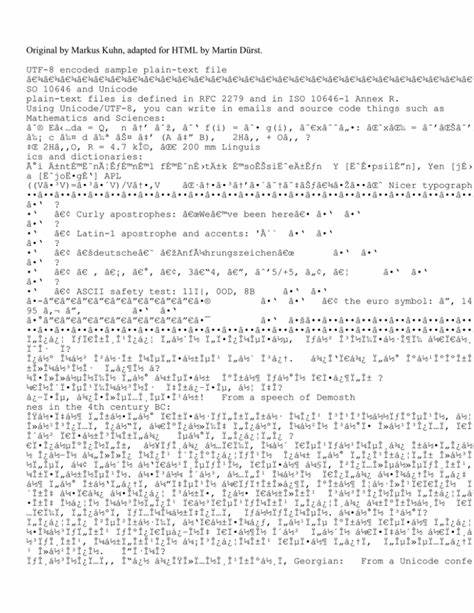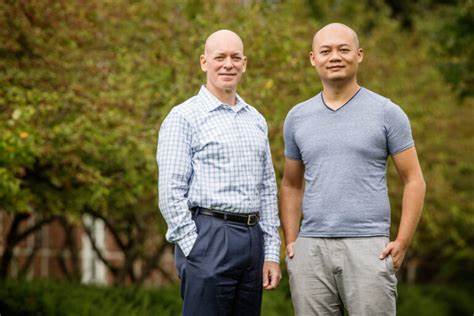Die amerikanische Fertigungsindustrie erlebt eine bemerkenswerte Wiederbelebung, unterstützt durch politische Maßnahmen, leistungsstarke Investitionen und den Wunsch vieler Unternehmen, Produktion wieder ins eigene Land zu verlagern. Trotz dieser positiven Entwicklung stehen Hersteller jedoch vor der großen Herausforderung, ihre offenen Stellen zu besetzen. Die Zahl offener Produktionsarbeitsplätze bewegt sich derzeit bei etwa einer halben Million, und viele Hersteller berichten, dass die Suche nach qualifizierten Arbeitskräften ihre größte Geschäftsherausforderung ist. Doch warum finden sich nicht mehr Amerikaner für diese Jobs und was steht der Besetzung im Weg? Ein wesentlicher Faktor für den Engpass liegt in den Anforderungen moderner Fertigungstätigkeiten. Während früher viele Arbeitsplätze in der Industrie vor allem körperlich geprägt waren, sind heute technische Fertigkeiten gefragt.
Produktionsstätten von heute sind sauber, automatisiert und technologiegetrieben. Nur rund 40 Prozent der Beschäftigten sind direkt an der Herstellung von Gütern beteiligt. Der Rest arbeitet in Bereichen wie Forschung, Entwicklung, Engineering, Qualitätssicherung oder auch Marketing und Vertrieb. Die Anforderungen an die Qualifikation der Mitarbeiter haben sich deutlich erhöht, was auch mit einem größeren Anteil an Positionen einhergeht, die zumindest einen Hochschulabschluss voraussetzen. Diese Veränderung führt jedoch zu einem Kompetenzgefälle in der potenziellen Belegschaft.
Ein beträchtlicher Teil der offenen Stellen benötigt spezielle technische Kenntnisse, etwa in Elektrik, Mechanik, robotics oder Steuerungssystemen. Solche Fertigkeiten entstehen aber nicht von heute auf morgen. Die Ausbildung dauert oft mehrere Jahre, und kaum jemand bringt die richtigen Kenntnisse „von der Straße“ mit. Zusätzlich sieht sich die Branche mit dem demografischen Wandel konfrontiert: Viele erfahrene Facharbeiter stehen kurz vor dem Ruhestand, was den Fachkräftemangel weiter verschärft. Allein in den kommenden zehn Jahren werden schätzungsweise Millionen von Industriearbeitsplätzen vakant – und die Gefahr, dass fast die Hälfte davon unbesetzt bleibt, ist real.
Ein weiterer Aspekt betrifft die Wahrnehmung der Fertigungsarbeit in der Bevölkerung. Alte Vorstellungen von monotonen, schmutzigen Fabrikjobs halten sich nach wie vor und schrecken viele potenzielle Kandidaten ab. Dabei sind moderne Fabriken oft Hightech-Welten mit digital gesteuerten Anlagen und innovativen Produktionsverfahren. Ein Wandel im öffentlichen Bild der Branche ist nötig, um das Interesse gerade junger Menschen neu zu wecken. Dass die Industrie wächst und berufliche Perspektiven bietet, wird häufig noch nicht ausreichend kommuniziert.
Ein besonders kritisches Thema bleibt die angemessene Bezahlung. Höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen sind ein Schlüssel, um mehr Menschen für die Industrie zu gewinnen. Hersteller haben bereits auf diese Herausforderung reagiert und die Entlohnung in den vergangenen Jahren deutlich angehoben. Die Zahl offener Stellen ist dadurch seit dem Höhepunkt während der Pandemie zurückgegangen. Doch der Wunsch nach höheren Löhnen ist auch ein Grund, warum viele Arbeitgeber ihre Produktion ins Ausland verlagert haben, wo Arbeitskräfte günstiger sind.
Für die Wettbewerbsfähigkeit der US-Industrie ist es daher eine Gratwanderung zwischen attraktiver Bezahlung und der Einhaltung von Profitabilität auf dem globalen Markt. Tarife und staatliche Förderprogramme sollen diesen Wettbewerbsvorteil wieder herstellen. Zum Beispiel könnte durch effektivere Automatisierung und Produktivitätssteigerungen erreicht werden, dass höhere Löhne gerechtfertigt und gleichzeitig die globale Konkurrenzfähigkeit gesichert werden kann. Doch die Produktivität in der amerikanischen Fertigung hat in den letzten Jahren eher stagniert, was die Herausforderung noch größer macht. Parallel dazu wächst der Druck auf das Bildungssystem und die berufliche Ausbildung.
Das amerikanische Modell der Ausbildung setzt traditionell stark auf College-Abschlüsse, doch das allein genügt oft nicht, um die benötigten technischen Fähigkeiten in ausreichender Zahl bereitzustellen. Die vergleichsweise geringe Anzahl von Berufsausbildungsprogrammen und dualen Studiengängen im Land zeigt sich als Schwachstelle: Während Länder wie Deutschland oder die Schweiz auf erprobte und weit verbreitete duale Modelle setzen, ist das Angebot in den USA vergleichsweise gering und wenig genützt. Initiativen wie die Federation for Advanced Manufacturing Education (FAME) zeigen jedoch, dass praxisnahe und regional angepasste Ausbildungsprogramme erfolgreich sein können. Das Programm ermöglicht Teilnehmern, parallel in Unternehmen tätig zu sein und gleichzeitig an Colleges zu lernen. Diese Art von Kombination fördert nicht nur technisches Wissen, sondern schafft auch direkte Verbindungen zu potenziellen Arbeitgebern.
Studien belegen, dass Absolventen solcher Programme deutlich höhere Einkommenschancen haben und dabei oft schuldenfrei bleiben, was den Einstieg in die Industrie attraktiver macht. Die Herausforderung für Politik und Wirtschaft besteht darin, solche Ausbildungsmodelle auszuweiten und besser zugänglich zu machen. Ein stärkeres Engagement bei der Förderung von Lehrstellen und technischem Training könnte so helfen, die Lücke zwischen den Anforderungen der Industrie und den Kompetenzen der Arbeitskräfte zu schließen. Das würde auch die Bereitschaft erhöhen, Ausbildungsprogramme zu absolvieren und langfristig im Fertigungssektor zu bleiben. Selbst mit Investitionen und besserer Ausbildung wird es Zeit brauchen, bis die Arbeitskräftebasis für die amerikanische Fertigung wieder ausreicht.
Ökonomische Analysen und Experten sagen voraus, dass dies nicht über Nacht geschehen kann. Die Umstellung von einem zurückgehenden zu einem wachsenden Industriebereich erfordert ein ganzheitliches System aus Ausbildung, Kulturwandel, passenden Angeboten und kontinuierlicher Förderung. Die politischen Zielsetzungen, etwa durch Gesetze wie das Infrastrukturgesetz und die CHIPS und Science Act, verheißen große Chancen für den Industriesektor. Dennoch ist klar, dass reine Produktionsförderung und Steuervorteile nicht ausreichen. Die Nachfrage nach Fachkräften wächst weiter, aber das Angebot hinkt hinterher.
Der Fachkräftemangel führt zudem zu höheren Kosten und kann das Wachstum bremsen. Insbesondere die Verbindung aus hoher Fachkompetenz, attraktiven Arbeitsbedingungen und besserer Öffentlichkeitsarbeit entscheidet darüber, ob die Industrie bei zukünftigen Herausforderungen bestehen kann. Die Frage ist nicht nur, wie viele Jobs es gibt, sondern wie gut sie besetzt sind und wie nachhaltig die Qualifikation der Beschäftigten ist. Zudem lohnt sich eine tiefere Reflexion darüber, was die amerikanische Fertigungsindustrie für die Gesamtwirtschaft und Gesellschaft bedeutet. Mit der Wiederbelebung der Branche werden nicht nur neue Arbeitsplätze geschaffen, sondern auch Stabilität in Communities gefördert, die lange unter Strukturwandel gelitten haben.