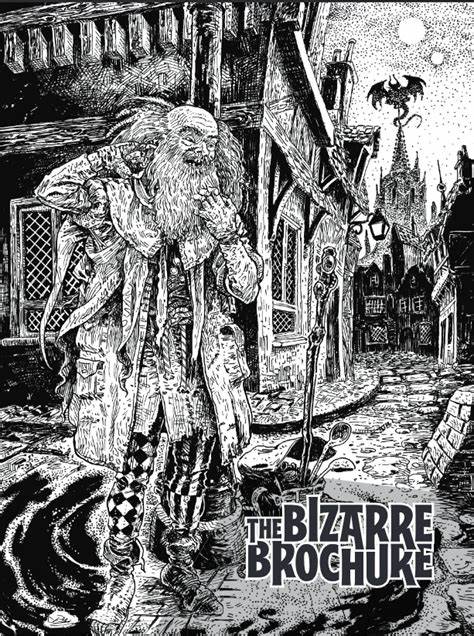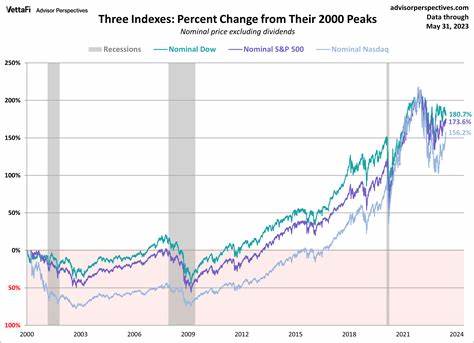Die globale Gesundheitslandschaft zeigt eine klare geschlechtsspezifische Ungleichheit: Männer leiden häufiger und sterben früher an vielen der weltweit führenden Krankheitsbilder als Frauen. Eine umfassende Studie, die auf Daten des Global Burden of Disease Study 2021 basiert und im Lancet Public Health veröffentlicht wurde, macht deutlich, dass Männer bei 13 von 20 Hauptursachen für Krankheit und Verletzungen stärker belastet sind als Frauen. Diese Ergebnisse werfen ein Licht auf die einzigartigen gesundheitlichen Herausforderungen, denen Männer gegenüberstehen, und verdeutlichen die Notwendigkeit gezielter gesundheitspolitischer Maßnahmen. Zu den Gesundheitsproblemen, bei denen Männer klar im Nachteil sind, zählen unter anderem COVID-19, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atemwegserkrankungen, Leberkrankheiten und Verkehrsunfälle. Besonders erschreckend ist, dass Männer an diesen Ursachen weit häufiger erkranken und sterben.
Im Fall von COVID-19 liegt die Belastung bei Männern um 45 Prozent höher als bei Frauen, mit den stärksten Auswirkungen in Regionen wie Subsahara-Afrika, Lateinamerika und der Karibik. Diese Diskrepanz verdeutlicht, wie biologische und soziale Faktoren über die Regionen hinweg zusammenwirken und zu unterschiedlichen gesundheitlichen Ergebnissen bei beiden Geschlechtern führen. Herzkrankheiten sind eine weitere Schlüsselursache, bei der Männer besonders betroffen sind. Studien zeigen, dass Männer weltweit etwa 45 Prozent mehr an Herzkrankheiten leiden und an den Folgen sterben als Frauen. Während die Belastung bei Männern in Zentral- und Osteuropa sowie Zentralasien besonders ausgeprägt ist, ist der Altersunterschied bemerkenswert: Die gesundheitlichen Risiken für Männer nehmen mit dem Alter zu und übersteigen die für Frauen immer deutlicher.
Diese Tendenz weist auf die Kombination aus biologischem Alterungsprozess und lebensstilbedingten Risiken hin. Die Faktoren, die hinter diesen geschlechtsspezifischen Unterschieden stehen, sind vielschichtig. Verhaltensweisen wie Rauchen, exzessiver Alkoholkonsum und riskantes Fahrverhalten beginnen häufig bereits in jungen Jahren und erhöhen die Wahrscheinlichkeit für spätere schwerwiegende Krankheiten und Verletzungen. Gerade Männer neigen dazu, medizinische Untersuchungen und Behandlungen zu meiden oder erst spät in Anspruch zu nehmen. Diese Verzögerung in der Gesundheitsvorsorge verschlimmert die Prognosen erheblich.
So führen oft vermeidbare oder behandelbare Zustände wie Bluthochdruck oder Diabetes bei Männern häufiger zu tödlichen Komplikationen. Verkehrsunfälle bilden eine Ausnahme in der Altersverteilung der Krankheitslast: Junge Männer im Alter von 10 bis 24 Jahren sind überproportional häufig von tödlichen und schweren Verkehrsunfällen betroffen. Diese Tatsache spiegelt gesellschaftliche und psychologische Faktoren wider, darunter ein höheres Risiko- und Unfallverhalten und geringere Nutzung von Schutzmaßnahmen wie Sicherheitsgurten oder Helmen. Die Folgen sind verheerend und tragen wesentlich zu vorzeitigem Tod und dauerhafter Behinderung in jungen Altersgruppen bei. Im Gegensatz zu Männern erleben Frauen zwar eine längere Lebenserwartung, jedoch leiden sie tendenziell mehr unter nicht-tödlichen Krankheitsbildern, die ihre Lebensqualität erheblich beeinträchtigen.
Muskuläre und Knochenerkrankungen, psychische Gesundheitsprobleme wie Depression und Angststörungen, und chronische Schmerzen sind bei Frauen häufiger. Beispielsweise führt Rückenschmerz weltweit bei Frauen zu einer deutlich höheren Krankheitslast als bei Männern, insbesondere in wohlhabenden Ländern und Lateinamerika. Diese gesundheitlichen Belastungen entwickeln sich bei Frauen häufig schon in frühen Lebensjahren und verstärken sich im Laufe der Zeit. Die Vernachlässigung dieser weiblichen Gesundheitsprobleme hat viele Auswirkungen. Gesundheitssysteme und Forschungsförderungen konzentrieren sich oft zu stark auf sexuelle und reproduktive Gesundheit und vernachlässigen dabei andere wichtige Bereiche wie psychische Gesundheit oder chronische Krankheiten bei Frauen.
Die daraus resultierende Versorgungslücke bedeutet, dass Millionen Frauen über Jahrzehnte hinweg eine unzureichende medizinische Betreuung erfahren und ihre Leiden systematisch unterschätzt werden. Doch die Unterschiede im Krankheitsverlauf und in der Sterblichkeit zwischen Männern und Frauen sind nicht allein biologisch erklärbar. Viele Faktoren sind sozial und kulturell geprägt. Geschlechterrollen, Erwartungen und Verhaltensmuster wirken sich unmittelbar auf das Gesundheitsverhalten aus. Männer, die traditionell eher als stark und widerstandsfähig gelten, greifen häufig seltener auf präventive Maßnahmen oder medizinische Hilfe zurück.
Zudem sind sie höheren sozialen Risikofaktoren ausgesetzt, etwa durch gefährliche Arbeitsplätze, höhere Unfallzahlen oder riskantes Verhalten in jungen Jahren. Diese Erkenntnisse führen zu einem klaren Aufruf für Politik, Gesundheitssysteme und Gesellschaft: Geschlechtsspezifische Unterschiede müssen bei Planung, Prävention und Behandlung von Krankheiten stärker berücksichtigt werden. Gesundheitsprogramme sollten sowohl die biologischen als auch die sozialen und kulturellen Aspekte einbeziehen, um wirkungsvollere Interventionen zu gestalten. Maßnahmen, die das Gesundheitsverhalten von Männern positiv beeinflussen, sind essenziell. Aufklärung zum Thema Rauchen, Alkohol und Verkehrssicherheit sollten bereits im Jugendalter ansetzen.
Regelmäßige Gesundheitschecks und Früherkennung müssen für Männer attraktiver und zugänglicher gemacht werden. Ebenso sind Supportsysteme notwendig, die männliche Patienten ermutigen, medizinische Hilfe frühzeitig in Anspruch zu nehmen, ohne Angst vor Stigma oder Schwäche zu haben. Auf der anderen Seite muss auch der Fokus auf die chronischen, nicht-tödlichen Erkrankungen bei Frauen verstärkt werden. Psychische Gesundheit, Schmerztherapie und nicht-übertragbare Krankheiten verlangen mehr Aufmerksamkeit und Ressourcen in Forschung und Versorgung. Eine ganzheitliche Betrachtung der weiblichen Gesundheit, die über die reine Reproduktionsmedizin hinausgeht, wird zur Verbesserung der Lebensqualität vieler Frauen beitragen.
Die Covid-19-Pandemie hat zusätzlich gezeigt, wie sehr sich Geschlechterunterschiede bei Gesundheitsrisiken und -ergebnissen bemerkbar machen können. Männer haben weltweit nicht nur eine deutlich höhere Sterberate an Covid-19, sondern auch ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe. Dies unterstreicht, wie wichtig es ist, Gesundheitsstrategien geschlechtsspezifisch auszurichten und potenzielle Risikogruppen gezielt zu schützen. Die Zukunft der globalen Gesundheit erfordert eine differenzierte und integrative Herangehensweise. Geschlechtsspezifische Analysen, wie sie in der Global Burden of Disease Study vorliegen, liefern essenzielle Grundlagen, um gesundheitspolitische Entscheidungen fundiert zu treffen.
Durch das Verständnis der unterschiedlichen Krankheits- und Sterberisiken bei Männern und Frauen können Programme effektiver gestaltet und gesundheitliche Ungleichheiten abgebaut werden. Zusammenfassend wird deutlich, dass Männer in vielen Teilen der Welt durch eine höhere Krankheits- und Sterblichkeitsrate von den 20 häufigsten Gesundheitsproblemen stärker belastet sind als Frauen. Um diese Diskrepanz zu verringern, sind gezielte Interventionen erforderlich, die sowohl verhaltensbezogene Risiken als auch den Zugang zum Gesundheitswesen verbessern. Gleichzeitig sollten weiterhin auch die langfristigen und nicht-lebensbedrohlichen Gesundheitsprobleme von Frauen nicht in Vergessenheit geraten, um eine umfassende und gerechte Gesundheitsversorgung für alle Menschen zu gewährleisten. Nur durch ein ganzheitliches Verständnis und die Umsetzung geschlechtergerechter Gesundheitspolitik kann die globale Gesundheitskrise, die Männer und Frauen unterschiedlich trifft, nachhaltig bewältigt werden.
Dabei gilt es, die individuellen Lebenswirklichkeiten, sozialen Einflüsse und biologischen Faktoren gleichermaßen zu berücksichtigen, um optimale gesundheitliche Ergebnisse zu erzielen und die Lebensqualität weltweit zu verbessern.