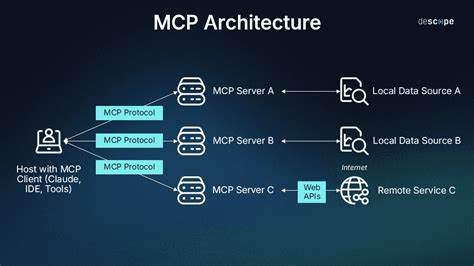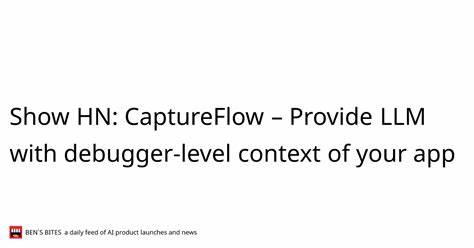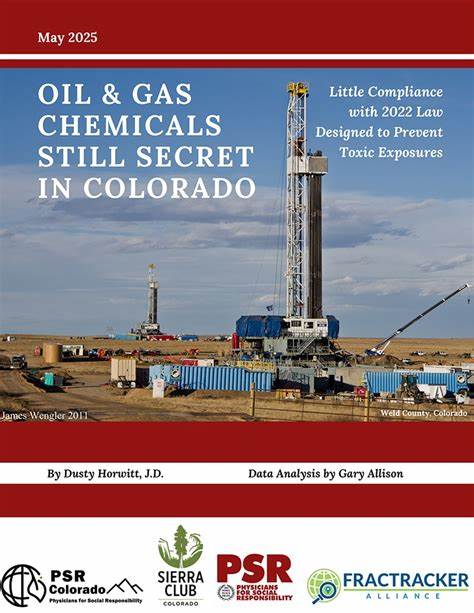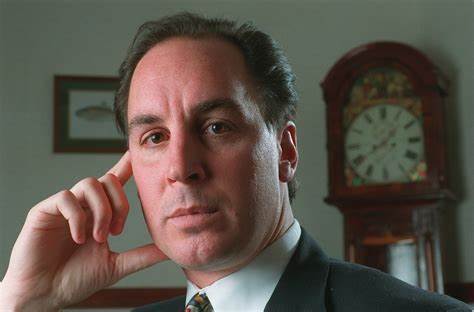Die revolutionäre Gentechnologie CRISPR, ein Werkzeug zur präzisen Genom-Editierung, hat nicht nur die biomedizinische Forschung grundlegend verändert, sondern auch juristische Auseinandersetzungen um Patentrechte hervorgerufen. Kürzlich hat ein US-Berufungsgericht entschieden, einen langjährigen Patentstreit wieder aufzunehmen, was vor allem den Nobelpreisträgern Jennifer Doudna und Emmanuelle Charpentier sowie den sie vertretenden Universitäten neue Chancen eröffnet. Die beiden Wissenschaftler hatten 2020 gemeinsam den Nobelpreis für Chemie erhalten, weil sie maßgeblich zur Entwicklung von CRISPR beigetragen haben. Ihr juristischer Kampf um die Anerkennung der Erfinderschaft im Wettbewerb mit dem Broad Institute, einer Kooperation von Harvard University und MIT, zeigt exemplarisch, wie Innovationsschutz in der modernen Biotechnologie funktioniert und wie bedeutsam solche Rechtsentscheidungen für Forschung und Wirtschaft sind. CRISPR ermöglicht es Forschern, DNA gezielt an bestimmten Stellen zu schneiden und zu verändern – eine Technologie, die das Potenzial hat, genetisch bedingte Krankheiten zu heilen und revolutionäre Therapien zu entwickeln.
Die ersten Patentanmeldungen zu CRISPR stammen von Doudna und Charpentier im Jahr 2012, während das Broad Institute bereits 2013 Patente für die Anwendung der Technologie in komplexeren eukaryotischen Zellen beantragte. Aufgrund unterschiedlicher Auffassungen darüber, welche Erfindung wirklich zuerst und vollständig konzipiert wurde, kam es zu gerichtlichen Verfahren, die sich über Jahre erstreckten und weltweit Beachtung fanden. Im Jahr 2022 hatte das US-Patentamt zugunsten des Broad Institute entschieden und argumentiert, dass deren Forscher die Anwendung von CRISPR auf eukaryotische Zellen zuerst entwickelt hätten. Die Universität von Kalifornien und die Universität Wien, die Doudna und Charpentier vertreten, legten jedoch Berufung ein und warfen der US-Patentbehörde vor, bei der rechtlichen Bewertung Fehler gemacht zu haben. Das Bundesberufungsgericht für den Bundesstaat Washington gab den Universitäten nun Recht und ordnete an, dass die Entscheidung vom Patent Trial and Appeal Board neu überprüft werden muss.
Diese Wende bedeutet, dass die Patentrechte abermals gründlich geprüft werden und Doudna sowie Charpentier die Möglichkeit erhalten, ihre Erfinderschaft zu untermauern. Die Entscheidung des Gerichts ist gleichzeitig ein Signal für den globalen Umgang mit geistigem Eigentum in Bereichen, in denen wissenschaftliche Innovationen besonders schnell voranschreiten und vielfach kommerziell genutzt werden. Die Komplexität von CRISPR patentrechtlich zu sichern, betrifft nicht nur juristische Feinheiten, sondern auch wirtschaftliche Interessen großer Forschungseinrichtungen und Unternehmen. Das Broad Institute äußerte sich zuversichtlich, dass seine Patente erneut bestätigt werden, da sich an den Fakten nichts geändert habe. Der Anwalt der Universität Kalifornien sieht in der Entscheidung hingegen eine Chance, „die bahnbrechende Technologie für die ganze Welt zugänglich zu machen“ und zu bestätigen, dass Doudna und Charpentier die ersten waren, die diese Technologie entwickelt haben.
Die juristische Austragung hat Auswirkungen über die bloßen Patentrechte hinaus: Die CRISPR-Technologie eröffnet Innovationen in der Medizin, der Landwirtschaft und den Biowissenschaften, und die Vergabe von Lizenzen beeinflusst, wie schnell und breit die Technologie angewandt werden kann. Seit den ersten Patenten haben zahlreiche Unternehmen auf der ganzen Welt begonnen, Therapien für bisher unheilbare Krankheiten zu entwickeln, darunter erblich bedingte Erkrankungen und schwerwiegende Tumorerkrankungen. Gleichzeitig ist CRISPR Gegenstand ethischer Debatten, insbesondere im Zusammenhang mit möglichen Veränderungen des menschlichen Erbguts. Die Patentstreitigkeiten verdeutlichen, wie eng Innovation, Kommerzialisierung und regulatorische Rahmenbedingungen miteinander verknüpft sind. Die Rolle der Universitäten in diesem Prozess ist von großer Bedeutung, da sie nicht nur wissenschaftliche Grundlagenarbeit leisten, sondern auch Innovationsrecht durchsetzen und durchsetzen lassen müssen, um die Finanzierung und Weiterentwicklung ihrer Forschung sicherzustellen.