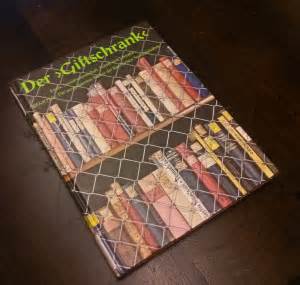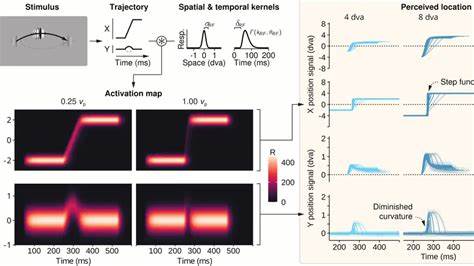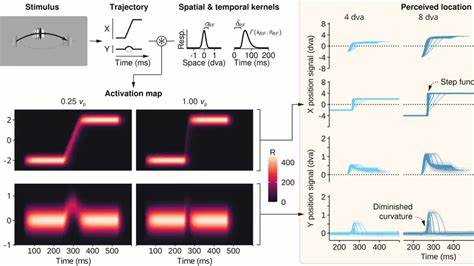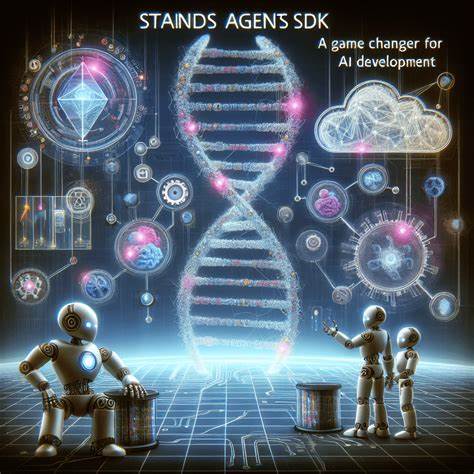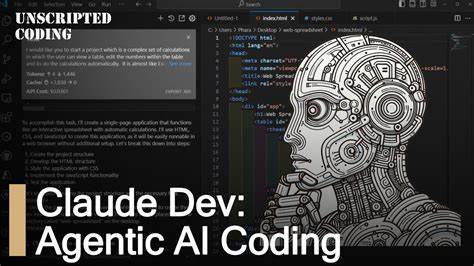Der Giftschrank ist mehr als nur ein physischer Aufbewahrungsort für Bücher. Der Begriff setzt sich aus den Wörtern „Gift“ und „Schrank“ zusammen und bedeutet wörtlich „Gift-Schrank“. In Bayern und insbesondere in der Bayerischen Staatsbibliothek in München wurden unter diesem Begriff jahrhundertelang Bücher gesammelt, die als gefährlich oder gesellschaftlich bedenklich betrachtet wurden. Der Giftschrank ist somit ein Spiegel der jeweiligen gesellschaftlichen Normen, Tabus und politischen Umbrüche, die sich über die Jahrhunderte in Deutschland vollzogen haben. Die Geschichte des Giftschranks beginnt bereits im 16.
Jahrhundert, in einer Zeit, in der die Religion eine dominante Rolle in Europa spielte. In den 1580er Jahren, als Bayern Teil des Heiligen Römischen Reiches war, galten die Lehren von Martin Luther und die wissenschaftlichen Erkenntnisse von Galileo Galilei als ketzerisch. Die katholische Obrigkeit wollte solche Werke zwar nicht zerstören, da diese die historischen Argumente der Gegner enthielten, doch gleichzeitig sollten diese Lehrtexte der Öffentlichkeit nicht zugänglich sein. Aus diesem Grund ordnete der Herzog von Bayern an, mehr als 500 dieser Werke in einer verschlossenen Kiste, dem ersten Giftschrank, aufzubewahren. Hierdurch sollte der Zugang streng limitiert bleiben, um Einfluss auf den Diskurs zu behalten und gleichzeitig unerwünschte Ideen fernzuhalten.
Mit dem Wandel der gesellschaftlichen Verhältnisse im Laufe der Jahrhunderte verschob sich auch der Fokus vieler Bibliotheken in Bezug auf den Giftschrank. Während anfangs religiöse Schriften und ketzerische Texte als gefährlich galten, rückten im 19. Jahrhundert zunehmend Werke in den Mittelpunkt, die sich um Sexualität und Erotik drehten. Ein Beispiel hierfür ist die private Sammlung erotischer Literatur des Sammlers Franz von Krenner, die vom bayerischen König nach dessen Tod übernommen wurde. Obwohl diese Bücher kontrovers betrachtet wurden, widersetzte sich die bayerische Staatsbibliothek dem Gedanken der Vernichtung und verwahrte die Sammlung im Giftschrank.
Somit wurde der Schrank auch zum Hort für Inhalte, die gesellschaftliche Tabus berührten und die öffentlichen Moralvorstellungen herausforderten. Die Weimarer Republik und die kulturelle Aufbruchsstimmung der 1920er Jahre in Deutschland eröffneten neue Perspektiven auf gesellschaftliche Themen wie Sexualität und Geschlechterrollen. Der Arzt Magnus Hirschfeld war ein Vorreiter der sexuellen Aufklärung und setzte sich für die Akzeptanz von Homosexualität und Transgender ein. Seine Schriften – die damals als radikal galten – fanden Beachtung in intellektuellen Kreisen, doch mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten änderte sich die Situation dramatisch. Hirschfelds Institut für Sexualwissenschaften wurde 1933 von der deutschen Studentenschaft, einer Organisation der Nationalsozialisten, gestürmt und viele seiner Bücher öffentlich verbrannt.
Viele weitere Schriften sowie Erotikbücher, die nicht in den Vorstellungen des NS-Regimes passten, fanden ihren Weg in den Giftschrank. Ein zentraler Wendepunkt für den Giftschrank war das Ende des Zweiten Weltkrieges. Nach der Niederlage Deutschlands erklärten die Alliierten den 8. Mai 1945 als Tag der Befreiung in Europa. Die deutsche Gesellschaft stand vor der Herausforderung, wie mit nationalsozialistischer Literatur umzugehen sei, insbesondere mit Adolf Hitlers Buch „Mein Kampf“, das in der Zeit des NS-Regimes millionenfach gelesen worden war.
Die endgültige Verwaltung der Rechte an diesem Werk wurde der bayerischen Staatsregierung übergeben, die jedoch keine Neuauflagen in deutscher Sprache zuließ. Stattdessen diente der Giftschrank fortan dazu, bestehende Exemplare zu sichern und den Zugang auf wissenschaftliche Zwecke zu beschränken. So wurde verhindert, dass unveränderte Ausgaben weiterhin politisch missbraucht werden konnten. Während der deutschen Teilung erhielt der Giftschrank eine besondere Bedeutung. In West- und Ostdeutschland entwickelten sich unterschiedliche politische Systeme mit eigenen Zugangsregeln zu kontroversen Schriften.
In der ehemaligen DDR fanden sich im Giftschrank neben den nationalsozialistischen Werken auch oppositionelle politische Texte, ausländische Literatur und Kulturmagazine, die von der staatlichen Zensur verboten waren. Zugang zu diesen Medien erhielten nur ausgewählte Akademiker, Studenten oder politische Inspekteure mit entsprechender Erlaubnis. Der Giftschrank wurde zu einem Fenster in die andere Welt, insbesondere für Ostdeutsche, die von westlicher Kultur und alternativen Ideen fasziniert waren. Heute hat der Giftschrank aufgrund der veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und der digitalen Verfügbarkeit vieler Texte an praktischer Bedeutung verloren. Die meisten Bibliotheken handhaben kontroverse Bücher heute differenzierter und ermöglichen Forschung und Aufklärung, anstatt komplexe Verbotsmechanismen einzusetzen.
Dennoch besteht weiterhin eine Art „virtueller Giftschrank“, insbesondere bei Werken wie „Mein Kampf“, die nach wie vor als ideologisch gefährlich eingestuft werden. So brauchen Interessierte beispielsweise häufig eine spezielle Berechtigung oder müssen ein legitimes Forschungsinteresse nachweisen, um Zugang zu erhalten. Interessant ist auch die neue, kritische Ausgabe von „Mein Kampf“, die seit dem Ablauf der Urheberrechte im Jahr 2016 veröffentlicht wurde. Herausgegeben vom Institut für Zeitgeschichte in München, besteht diese Ausgabe aus zwei umfangreichen Bänden, die den Text Hitlers mit tausenden Anmerkungen und Kommentaren versehen, um die ideologischen Irrtümer und Gefahren zu enttarnen. Diese kommentierte Fassung ist bewusst als Instrument für wissenschaftliches Studium konzipiert und könnte als eine Art mobiler Giftschrank betrachtet werden, der das Buch einrahmt und vor einer falschen Lesart schützt.