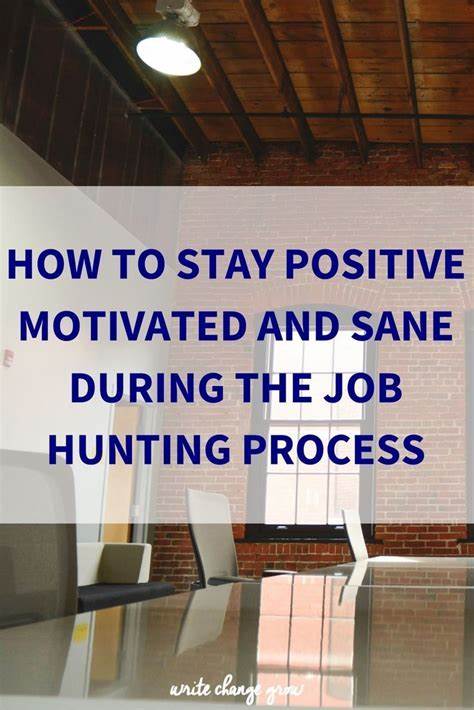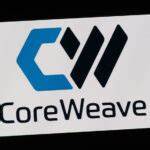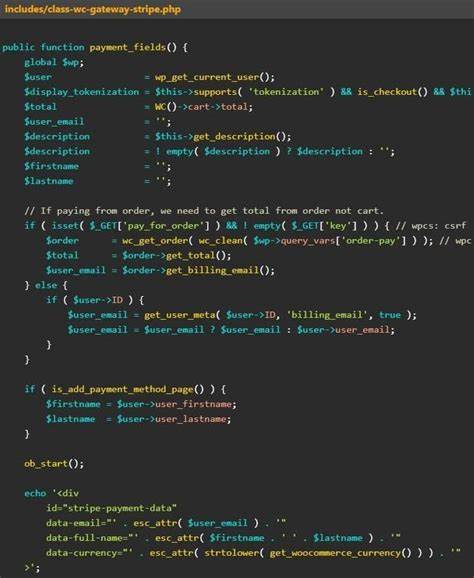Die Auswahl von Führungskräften ist eine der wichtigsten Entscheidungen innerhalb eines Unternehmens, da diese Positionen weitreichende Auswirkungen auf die strategische Ausrichtung und finanzielle Stabilität haben können. Dabei steht die Legitimität von Auswahlprozessen zunehmend im Fokus der Forschung, insbesondere wie vermeintliche Erfolgsindikatoren bei der Beförderung von internen Kandidaten zu CEO-Posten die langfristige Performance beeinflussen. Ein bahnbrechendes Forschungsprojekt mit dem Titel „Toxic Origins, Toxic Decisions: Biases in CEO Selection“ beleuchtet dabei ungewöhnliche Zusammenhänge, die weit über klassische HR-Themen hinausgehen. Es verbindet individuelle pränatale Umwelteinflüsse mit risikobezogenem Verhalten in unternehmerischer Führung und zeigt auf, wie solche Einflüsse die Wahrnehmung von Erfolg verzerren und so „toxische“ Entscheidungsprozesse fördern können. In der Studie wird untersucht, wie die Exposition pränatale Umweltrisiken – in diesem Fall das Aufwachsen in sogenannten Superfund-Gebieten, welche durch Umweltverschmutzung stark belastet sind – als exogene Variable genutzt wird, um individuelle Risikoneigungen zu identifizieren.
Diese informelle „natürliche“ Experimentierräumlichkeit erlaubt es Forschern, Zusammenhänge zwischen frühen Umwelteinwirkungen und späteren Verhaltensweisen als Unternehmenlenker zu analysieren. Bemerkenswert ist, dass diese sogenannten „Superfund CEOs“ dabei häufiger intern befördert werden, weil ihre bisherigen Leistungen anhand kurzfristiger Erfolge scheinbar überzeugend sind. Das Unternehmen belohnt so unbewusst riskante Verhalten, ohne die zugrundeliegenden Risikopräferenzen richtig zu deuten. Die Folgen für das Unternehmen sind vielschichtig. Während diese CEOs intern offensichtlich leistungsstark erscheinen und kurzfristig Erfolge vorweisen, zeigen sie bei der Übernahme verantwortungsvoller externer Entscheidungen, welche irreversible Risiken mit sich bringen, ein signifikant volatileres und weniger stabiles Verhalten.
Dies geht mit schlechteren finanziellen Ergebnissen und einer insgesamt geringeren Stabilität der Unternehmensperformance einher. Kurz gesagt, täuschen kurzfristige Glücksmomente und risikoaffine Strategien über langfristige Nachteile hinweg, was für Unternehmen ein vernichtendes Erbe bedeutet. Die Forschungsarbeit weist damit auf eine entscheidende Verzerrung hin: Firmen neigen dazu, Glück mit Kompetenz zu verwechseln und so bevorzugt Kandidaten auszuwählen, die ein hohes Maß an Risikobereitschaft mitbringen. Diese Tendenz wird durch die „toxischen Ursprünge“ der betroffenen Personen noch verschärft, indem extreme Umweltfaktoren die Risikobereitschaft in der Kindheit und Jugend prägen. Solche Entscheidungen schließen folglich eine versteckte Form von Bias ein, welche erst bei steigender Verantwortung und größerem Einfluss auf externe Risiken sichtbar wird.
Aus praktischer Sicht offenbart dies wesentliche Schwächen klassischer CEO-Auswahlverfahren. Häufig orientieren sich Unternehmensvorstände an vergangenen Leistungskennzahlen und kurzfristigen Erfolgen, ohne die individuellen Persönlichkeitsmerkmale und Risikoneigungen ausreichend einzubeziehen. Selbst moderne Führungskräfteentwicklungskonzepte lassen Aspekte wie pränatale Belastungen oder deren Konsequenzen für psychologische Verhaltensweisen meist unerwähnt. Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass eine ganzheitlichere Evaluation dringend notwendig ist, um nachhaltige Unternehmensführung zu gewährleisten. Darüber hinaus berührt die Analyse wichtige gesellschaftliche und ethische Fragen.
Die Erkenntnis, dass Umweltverschmutzung langfristig nicht nur die physische Gesundheit, sondern auch wirtschaftliche Führungskompetenzen beeinflussen kann, öffnet Debatten rund um Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit. Unternehmen sollten daher auch die Herkunft und Lebensbedingungen von Führungskräften als Teil ihres Corporate-Governance-Rahmens berücksichtigen. Ebenso zeigt sich, wie tiefgreifend und vielseitig Umweltfaktoren menschliche Entscheidungen und deren Folgen prägen können. Für Manager, HR-Experten und Aufsichtsräte bedeutet dies eine Herausforderung und zugleich eine Chance. Indem sie Auswahlprozesse reflektieren und Biases in der Beförderungssystematik erkennen, können sie passende Maßnahmen entwickeln, um risikoadäquate Führungskräfte zu identifizieren und fördern.
Zugleich können sie durch gezielte Förderung einer diversifizierten Führungskultur und mehr Transparenz in Entscheidungsprozessen das Risiko toxischer Entscheidungen minimieren. Die Studie „Toxic Origins, Toxic Decisions“ bietet eine innovative Perspektive auf CEOs als Risikofaktoren und nicht nur als Leistungsträger. Sie verbindet Erkenntnisse aus Umweltökonomie, Gesundheitsökonomie und Unternehmensführung und zeigt, wie Wissenschaft Schlüsselprozesse der Wirtschaft transparenter und nachvollziehbarer macht. Damit liefert sie eine wertvolle Basis für weiterführende Forschung und praxisorientierte Empfehlungen, die letztlich zum Ziel haben, Unternehmen effektiver, resilienter und nachhaltiger zu führen. Zusammenfassend zeigt sich: Die Auswahl von CEOs sollte nicht allein kurzfristigen Erfolgen und traditionellen Leistungskennzahlen folgen, sondern die latenten Risikoneigungen und deren bio-soziale Hintergründe berücksichtigen.
Nur so können Unternehmen vermeiden, ungewollt riskante Führungspersönlichkeiten zu begünstigen, deren Entscheidungen den langfristigen Erfolg gefährden. Eine bewusste Auseinandersetzung mit „toxischen“ Ursprüngen und deren Auswirkungen ermöglicht eine fundierte CEO-Entscheidung, die der Komplexität moderner Unternehmensführung gerecht wird. Für Unternehmen, die in einer volatilen Wirtschaftsumgebung bestehen wollen, ist dies essenziell.