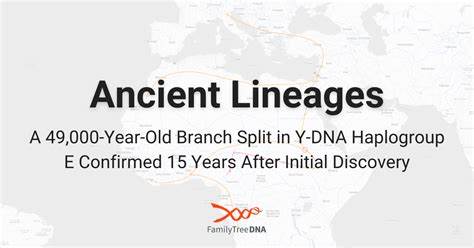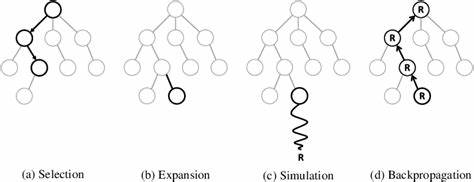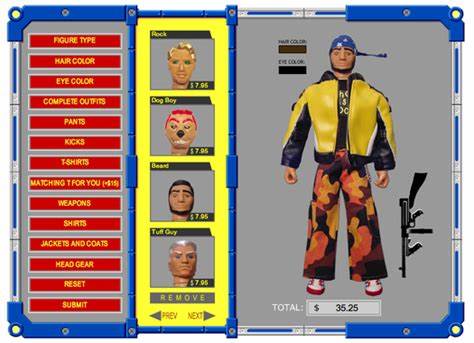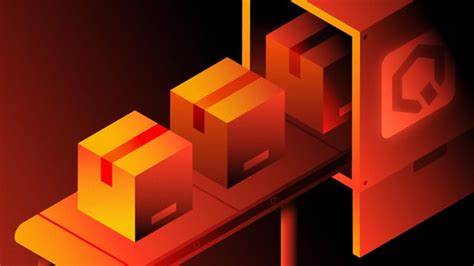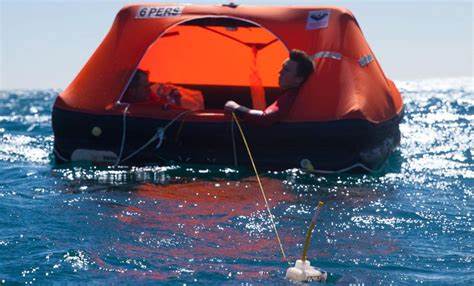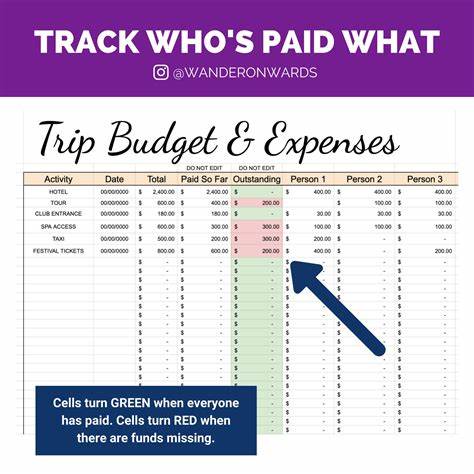Die Sahara – heute weltweit als größte heiße Wüste bekannt – war vor etwa 14.500 bis 5.000 Jahren ein blühendes, grünes Savannenland. In dieser Zeitspanne, die als Afrikanische Humide Periode (AHP) bezeichnet wird, fanden sich dort reichlich Wasserquellen, Seen und Flusssysteme, die sowohl Pflanzen- als auch Tierleben förderten und Menschen eine bewohnbare Umwelt boten. Aktuelle Forschungen und insbesondere neue Entdeckungen aus dem Bereich der antiken DNA (aDNA) eröffnen nun ein überraschendes Fenster in die Vergangenheit dieser Region.
Sie zeigen, dass die Bevölkerung, die in der Mitte des Holozäns in der Sahara lebte, genetisch eng mit einer bislang unbekannten nordafrikanischen Abstammungslinie verwandt ist. Diese Entdeckung verdeutlicht die Komplexität der menschlichen Besiedlung und den kulturellen Wandel in Nordafrika weit über bisherige Annahmen hinaus. Der wichtigste Fundort für diese Studie ist das Takarkori-Fels Shelter in den Tadrart Acacus Bergen im Südwesten Libyens. Dort wurden Überreste von mindestens 15 Personen entdeckt, die zwischen 8.900 und 4.
800 Jahren vor heute lebten. Besonders interessant sind zwei der weiblichen Individuen aus der sogenannten Mittel-Archaischen Periode, deren DNA umfangreich analysiert werden konnte. Die genetischen Daten belegen, dass ihre Abstammung hauptsächlich von einer tief getrennten nordafrikanischen Population stammt, die sich bereits sehr früh vom Großteil der unterafrikanischen Populationen abzweigte. Diese Linie blieb über tausende von Jahren geografisch und genetisch isoliert, kam nur wenig oder gar nicht mit sub-saharischen Gruppen in Kontakt und hatte geringe, aber nachweisbare genetische Vermischungen mit Bevölkerungen aus dem Nahen Osten. Die genetische Nähe zwischen den Takarkori-Individuen und den etwa 15.
000 Jahre alten Foragern aus der Höhle Taforalt im heutigen Marokko unterstreicht eine lange Kontinuität dieser nordafrikanischen Linie. Die Taforalt-Menschen sind mit der sogenannten Iberomaurusischen Kultur verbunden, einer spätpaläolithischen Steinzeitkultur, die weit vor der Grünen Sahara existierte. Trotz der geographischen Entfernung und der langen Zeitspanne zeigen die beiden Gruppen eine enge genetische Verwandtschaft. Diese Tatsache spricht für eine frühzeitige, nachhaltige Isolation Nordafrikas gegenüber den restlichen afrikanischen Populationen und legt nahe, dass die Sahara – selbst während klimatisch günstiger Phasen – eine bedeutende Barriere darstellte. Die Studie ergab zudem, dass die bekannten genetischen Spuren des Neandertalers, die außerhalb Afrikas sehr ausgeprägt sind, in den Takarkori-Proben nur minimal vorhanden sind.
Während Menschen aus Europa oder dem Nahen Osten bis zu zwei Prozent Neandertaler-DNA tragen, weisen die Takarkori-Frauen nur etwa ein Zehntel dieser Werte auf – mehr als in heutigen unterafrikanischen Bevölkerungen, aber deutlich weniger als in außereuropäischen Populationen. Dieses Ergebnis bestätigt die These, dass die Takarkori-Linie lange unabhängig von den Bevölkerungen war, die während der Ausbreitung des modernen Menschen außerhalb Afrikas mit Neandertalern Kontakt hatten. Ein weiterer faszinierender Aspekt der Forschung ist die Rolle der Pastoralwirtschaft in der Grünen Sahara. Archäologische Befunde belegen, dass vor rund 8.300 Jahren Viehhalterinnen und Viehhalter mit ihren Tieren über die Region zogen.
Die genetischen Daten zeigen jedoch, dass diese Wirtschaftsform nicht notwendigerweise durch massive Einwanderung anderer Gruppen verbreitet wurde. Stattdessen lässt sich besser ein kultureller Austausch oder eine Übernahme ökonomischer Praktiken ohne größere menschliche Migration nachweisen. Das heißt, die autochthone Bevölkerung Nordafrikas hat die neolithischen Technologien vermutlich übernommen und weiterentwickelt, ohne durch Zuwanderung stark verdrängt oder genetisch überlagert zu werden. Diese Erkenntnisse stehen im Kontrast zu anderen Teilen Afrikas, wo die Einführung der Viehzucht häufig mit dem Eindringen neuer Bevölkerungsgruppen einherging. Im Maghreb etwa kamen zu bestimmten Phasen bäuerliche Gruppen aus Europa und dem Nahen Osten, was eine stärkere genetische Vermischung mit sich brachte.
Im Gegensatz dazu scheint der zentrale Teil der Sahara durch geografische und ökologische Bedingungen eine stärkere genetische Isolation bewahrt zu haben. Die Analyse des mitochondrialen Erbguts der Takarkori-Individuen ergänzte diese Story. Beide Frauen trugen eine basale Untergruppe des Haplogruppen-Komplexes N, die eine der ältesten Linien außerhalb des subsaharischen Afrikas repräsentiert. Die Datierung zeigt, dass diese Linie bereits vor etwa 60.000 Jahren existierte – deutlich vor der weit verbreiteten Ausbreitung moderner Menschen nach Eurasien.
Die mtDNA-Befunde bestätigen somit, dass Nordafrika schon sehr früh eine eigene genetische Geschichte durchlebte, die teils parallel zu jener des restlichen Afrikas verlief. Die genetische Kontinuität zwischen den Takarkori-Bewohnern und den Taforalt-Foragern ist besonders wichtig, um ein vorher ungeklärtes Element in der Bevölkerungsdynamik zu verstehen. Frühere Studien hatten eine Mischung aus nahöstlicher (Natufier) und sub-saharischer Herkunft im Taforalt-Menschen angenommen. Neuere Modellierungen bringen nun das Takarkori-ähnliche Ureinwohner-Genom als viel präziseren Vertreter für das nordafrikanische Element. Demnach ergibt sich ein Mischungsverhältnis von ungefähr 60 Prozent nahöstlichen Ursprungs und 40 Prozent autochthoner nordafrikanischer Abstammung.
Einschränkend ist anzumerken, dass trotz des feuchteren Klimas während der Grünen Sahara keine Hinweise auf nennenswerte Genströmungen aus dem südlichen Afrika in den Norden zu finden sind. Trotz der Öffnung der Landschaft für Wanderungen und Handel hatten die Bevölkerungssysteme aufgrund ökologischer Fragmentierung, kultureller Differenzierung und sozialer Barrieren kaum genetische Vermischung zur Folge. Die Sahara blieb somit ein wirksamer genetischer und kultureller Pufferraum. Die Forschungsergebnisse leisten nicht nur einen wesentlichen Beitrag zur Rekonstruktion der prähistorischen Bevölkerungsstruktur Nordafrikas, sondern werfen auch ein neues Licht auf die Verbreitung menschlicher Kulturen und Technologien. Die Grüne Sahara diente als Bühne für die Ausbildung eines bedeutsamen nordafrikanischen Genpools, der heutige Bevölkerungsgeschichten maßgeblich beeinflusste.
Die Ergebnisse werfen außerdem Fragen zum Tempo und den Wegen der Neolithisierung in Afrika auf, indem sie einen deutlichen Fall kultureller Diffusion gegenüber genetischer Migration dokumentieren. Zukunftsperspektiven zeigen, dass weitere aDNA-Forschungen an anderen Fundstellen der Sahara und angrenzender Regionen notwendig sind, um die genetischen Verflechtungen über das gesamte nordafrikanische Gebiet besser zu verstehen. Technologische Fortschritte in Sequenzierungsmethoden und der Analyse geringer DNA-Mengen versprechen tiefergehende Einblicke, die gerade in Regionen mit schwierigeren Erhaltungsbedingungen bislang kaum möglich waren. Zusammenfassend zeigt die Analyse antiker DNA aus der Grünen Sahara, dass die frühgeschichtlichen Menschen dort eine tief verwurzelte, eigenständige nordafrikanische Linie repräsentierten. Diese Linie war sowohl genetisch isoliert als auch kulturell dynamisch und prägte die menschliche Geschichte Nordafrikas nachhaltig.
Die Erkenntnisse unterstützen ein umfassenderes Bild von prähistorischer Mobilität, kulturellem Wandel und Bevölkerungsdynamik in einem der faszinierendsten und bislang am wenigsten verstandenen Gebiete der Menschheitsgeschichte.