Die Luftfahrtindustrie steht vor einer weiterhin dynamischen, jedoch auch herausfordernden Zukunft. Boeing, einer der weltweit führenden Flugzeughersteller, hat kürzlich seine 20-Jahres-Prognose für die Nachfrage nach neuen Flugzeugen veröffentlicht und dabei die bisherigen Erwartungen leicht heruntergeschraubt. Dieses Update kommt in einer Zeit, in der der gesamte Sektor versucht, sich von den tiefgreifenden Auswirkungen der Corona-Pandemie zu erholen und gleichzeitig mit geopolitischen Spannungen sowie wirtschaftlichen Schwankungen zurechtzukommen. Boeing erwartet nun, dass weltweit rund 43.600 neue Flugzeuge bis zum Jahr 2044 benötigt werden, was im Wesentlichen mit der Zahl aus der Vorjahresprognose vergleichbar ist – damals lag die Prognose für 43.
975 Flugzeuge bis 2043. Die leichte Anpassung zeigt jedoch eine vorsichtigere Einschätzung vor allem beim Wachstum des Passagierverkehrs und der wirtschaftlichen Entwicklung. Obwohl Boeing seine Prognose für die Anzahl neuer Flugzeuge fast unverändert gelassen hat, wurde das erwartete Wachstum des Passagieraufkommens von 4,7 Prozent auf 4,2 Prozent pro Jahr gesenkt. Zudem wurde das globale Wirtschaftswachstum von 2,6 auf 2,3 Prozent nach unten korrigiert. Auch die Erwartungen für das Wachstum des Frachtverkehrs wurden verringert, was auf die komplexen und volatilen Handelsbeziehungen sowie die anhaltenden Herausforderungen im globalen Lieferkettenmanagement zurückzuführen ist.
Trotz dieser Anpassungen bleibt die langfristige Nachfrage nach Flugzeugen robust. Boeing prognostiziert, dass mehr als 40 Prozent Zunahme im globalen Luftverkehr bis 2030 erreicht werden – ein Wert, der den Bedarf nach modernen und effizienteren Jets weiter antreiben wird. Insbesondere der Markt für Single-Aisle-Flugzeuge, also vor allem Kurz- und Mittelstreckenjets wie der Boeing 737 MAX und die Airbus A320neo-Familie, bleibt dominant und macht etwa vier von fünf Neuaufträgen aus. Die breite Nachfrage in diesem Segment spiegelt die zunehmende Bedeutung des Kurzstreckenverkehrs wider, der durch den boomenden Reiseverkehr in aufstrebenden Regionen wie China, Südasien und Südostasien mitgetrieben wird. Diese Regionen sind für rund die Hälfte des erwarteten Kapazitätszuwachses verantwortlich.
Die Nachfragetreiber sind dabei weniger Ersatzkäufe für in die Jahre gekommene Flugzeuge als vielmehr Wachstum des Verkehrs. Boeing sieht rund 51 Prozent der künftigen Flugzeugnachfrage als Wachstumsmotor und nur 49 Prozent als Ersatzbedarf. Die zunehmende Urbanisierung, steigernde Wohlstandsniveaus und eine wachsende Mittelschicht in großen Wachstumsmärkten sorgen für eine langfristige Expansion des Luftverkehrs. Die Herausforderungen für Boeing liegen jedoch nicht nur in der reinen Nachfrage, sondern auch in der Fähigkeit, Flugzeuge termingerecht und in ausreichender Zahl zu liefern. Seit der Pandemie ist die Flugzeugproduktion deutlich langsamer als vor COVID-19, mit einem geschätzten Rückstand von 1.
500 bis 2.000 Flugzeugen weltweit. Produktionsengpässe, Qualitätsprobleme und jüngste Sicherheitsvorfälle, wie der Zwischenfall mit einem Boeing 737 MAX bei Alaska Airlines im Jahr 2024 sowie der tragische Absturz eines Boeing 787-8 Dreamliners in Indien im Jahr 2025, haben die Pläne des Herstellers erschwert. Die US-Luftfahrtaufsichtsbehörde FAA hat zudem die Produktionsrate des 737 MAX begrenzt, was die ohnehin knappen Produktionskapazitäten weiter einschränkt. In diesem Umfeld hat Boeing zwar Fortschritte bei der Qualitätsverbesserung gemacht, sieht sich aber weiterhin mit einem erhöhten Druck konfrontiert, Sicherheit, Zuverlässigkeit und Produktionseffizienz zu gewährleisten.
Der Ausfall eines Flugzeugsystems kann gravierende Auswirkungen haben und somit auch die Nachfrage und das Vertrauen in die Marke beeinflussen. Auf geostrategischer Ebene beeindruckt die Bedeutung des chinesischen Marktes, der einen wesentlichen Teil der Bestellungen ausmacht. Nach einer Phase der Lieferunterbrechungen aufgrund von Handelsspannungen zwischen China und den USA zeichnet sich eine baldige Fortsetzung der Flugzeugauslieferungen ab. China wird voraussichtlich weiterhin eine Schlüsselrolle sowohl beim Wachstum als auch bei der Erneuerung der Flotten spielen. Auch Eurasien und Nordamerika werden für den Ersatz älterer Flugzeuge entscheidend sein.
Die Konkurrenz zwischen Boeing und Airbus bleibt damit unvermindert stark. Airbus hat in seiner eigenen 20-Jahres-Prognose jüngst seine Nachfrage leicht erhöht und prognostiziert etwa 43.420 neue Flugzeuge. Beide Hersteller zeigen sich vorsichtig optimistisch, was die Widerstandsfähigkeit des Luftverkehrs angeht, trotz aktueller globaler Unsicherheiten. Weitere Faktoren, die die langfristige Entwicklung beeinflussen, sind technologische Innovationen und die zunehmende Bedeutung von Nachhaltigkeit.
Die Luftfahrtindustrie steht unter Druck, ihre Umweltbilanz zu verbessern und neue Flugzeuge mit reduzierten Emissionen zu entwickeln. Boeing arbeitet an nachhaltigen Flugzeugtechnologien und treibt die Entwicklung von alternativen Kraftstoffen und effizienteren Triebwerken voran. Das ändert nicht nur den Wettbewerb, sondern auch die Anforderungen an zukünftige Flugzeugflotten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Boeing mit der jüngsten Anpassung seiner Prognose realistische Erwartungen an das globale Marktwachstum setzt. Trotz Herausforderungen wie Produktionsengpässen, Sicherheitsfragen und geopolitischen Unsicherheiten bleibt der langfristige Bedarf nach neuen Flugzeugen in Milliardenhöhe gegeben.
Die Luftfahrtbranche wird in den kommenden zwei Jahrzehnten geprägt sein von Wachstumsmärkten wie China und Südasien, einem Fokus auf Kurzstreckenjets sowie der Notwendigkeit, nachhaltige und sichere Flugzeuge zu produzieren. Flugzeughersteller, Fluggesellschaften und Zulieferer müssen sich gleichermaßen auf diese komplexe Mischung aus Chancen und Risiken einstellen, um im dynamischen weltweiten Luftverkehr bestehen zu können.



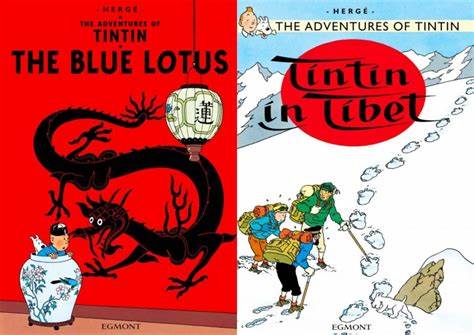
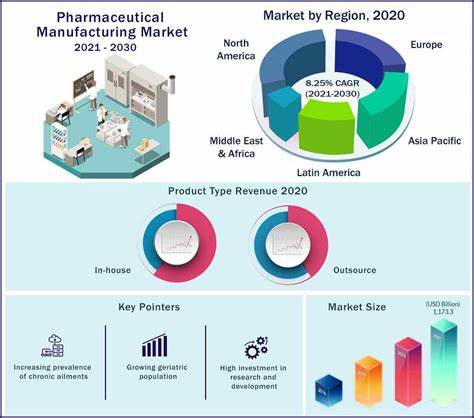
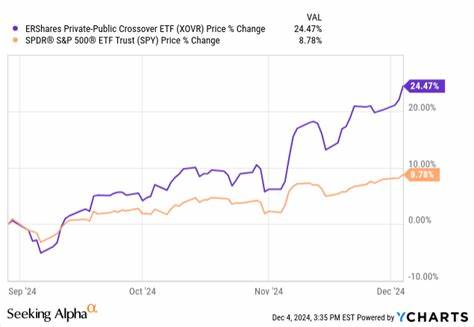
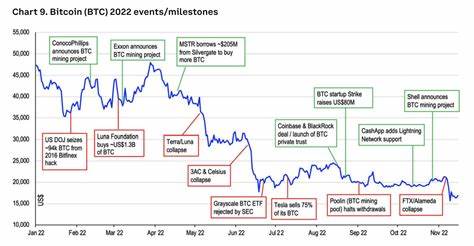

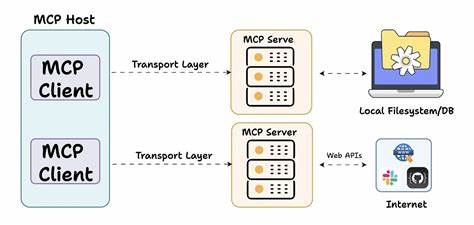
![ChatGPT: H1 2025 Strategy [pdf]](/images/5C21D689-B099-4A2B-8E74-6F111D84BE15)